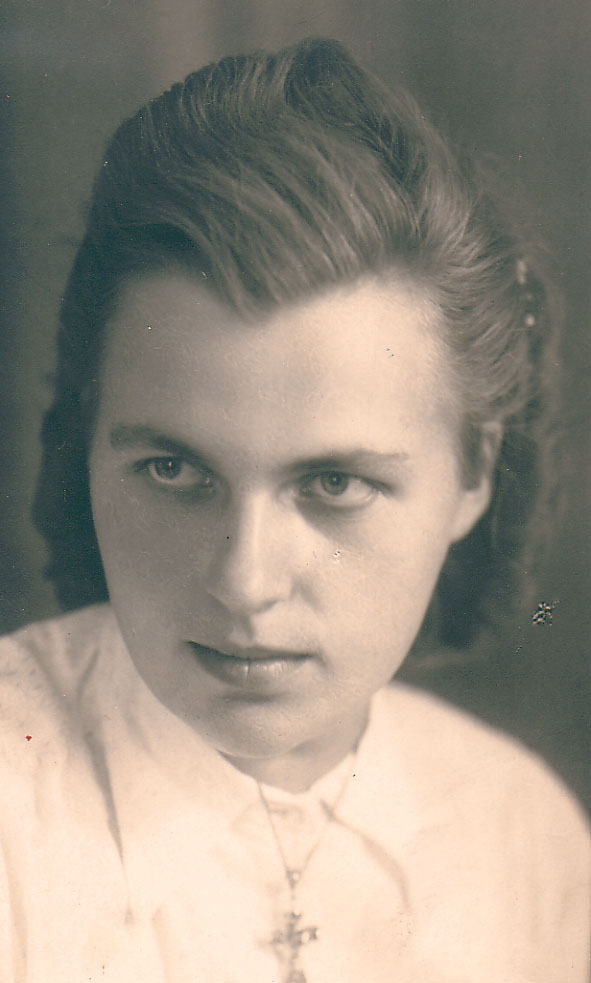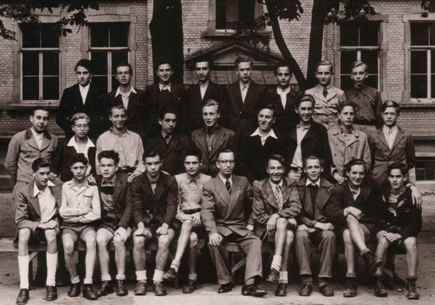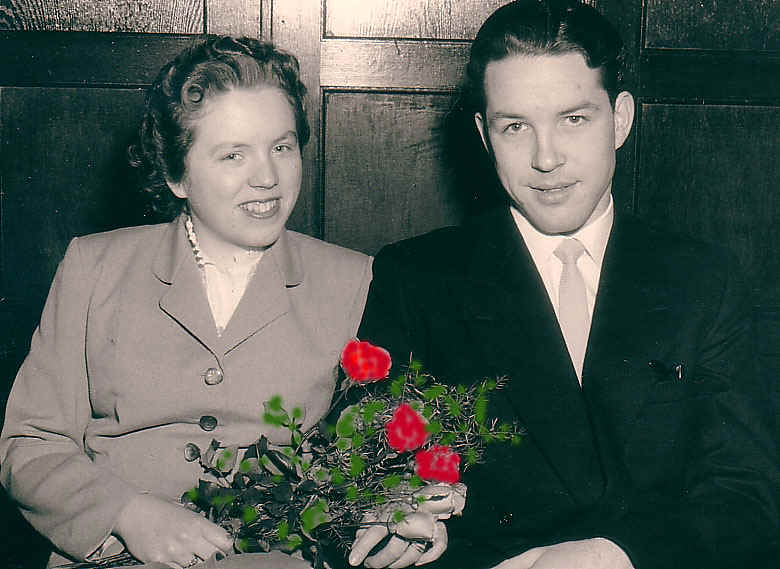Kindheit und Jugend
Erinnerungen
von
Josef Brieler
"Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht."
(Art. 6 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes)
* * *
"Die Eltern haben das natürliche Recht und die oberste Pflicht, ihre Kinder zur leiblichen, sittlichen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit zu erziehen."
(Art. 25 Abs. 1 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz)
* * *
Nach den folgenden Darstellungen aus meiner Erinnerung bin ich überzeugt, daß meine Eltern ihrer grundgesetzlichen und verfassungsrechtlichen Verpflichtung in jeder Weise und zu jeder Zeit gerecht geworden sind. Dafür danke ich ihnen herzlich!
* * *
Anmerkung:
Der nachfolgende Beitrag "Kindheit und Jugend - Erinnerungen"
ist im Jahre 1997 im Eigenverlag auch als Buch erschienen.
(klicken Sie auf einen Titel des Inhaltsverzeichnisses und der entsprechende Artikel wird Ihnen angezeigt)
Vorwort
Der Weg und die Heimkehr nach Neuendorf
Die Kunst des Überlebens nach dem Krieg und die „Währungsreform”
„Singe, wem Gesang gegeben“
Start in einen Beruf und Marlies tritt in mein Leben
* * *
V o r w o r t
(1) - Wie schon bei der ersten Auflage 1997 habe ich auch bei der zweiten nunmehr vorliegenden Auflage die ursprüngliche deutsche Schreibweise beibehalten und somit nicht nur die erste Rechtschreibreform 1995, sondern auch die zweite Rechtschreibreform 2005 unberücksichtigt gelassen; denn weder die erste noch die zweite Reform sind vom deutschen Volk nicht wirklich angenommen worden.
Die in der ersten Ausgabe vorhandenen orthografischen Fehler sind nunmehr behoben. Außerdem sind als wichtiges Merkmal jetzt viele eigene Fotos der Familie und solche aus Familienbeständen eingefügt worden, was zu einer besseren Gesamtdarstellung geführt hat.
Neuhäusel, im Juni 2007
Der Verfasser
* * *
V o r w o r t zur ersten Auflage 1997
(1) - Ob man sich noch an alles erinnern kann, wenn man schon fünfundsechzig ist, und der Gedanke immer wieder auftaucht, sein Leben aufzuschreiben, um es seinen Kindern und Enkeln aufzuschließen? Man wird sich wohl kaum an alles erinnern können. Und ob es eine gute Idee ist, sein Leben den Nachkommen zu offenbaren; das weiß ich jetzt, wo ich beginne es aufzuschreiben, auch noch nicht so genau. Vielleicht sind sie überhaupt nicht interessiert daran.
Keiner meiner drei Söhne hat je von sich aus etwas zu diesem Gedanken gesagt. Aber in Gesprächen mit meinen Geschwistern, deren ich fünf habe, von denen der älteste meiner zwei Brüder leider schon im Alter von 52 Jahren verstorben ist, kam wiederholt die Aufforderung an mich, meine Erlebnisse doch aufzuschreiben. Ich bin älter als alle Geschwister, und gerade in den Kriegswirren von 1939 bis 1945 gab es einiges, was ich intensiver erlebt habe als sie, obwohl ich bei Kriegsende selbst gerade erst dreizehn geworden war.
Aber da gibt es immer wieder die Zweifel: Interessiert es wirklich überhaupt jemand? Bin ich gar selbst daran interessiert? Ist es nicht überzogene Selbsteinschätzung oder Eitelkeit, sein Leben aufzuschreiben? Für wen? ‘Schon wieder einer, der Memoiren schreibt’, könnte der eine oder andere denken. Und wenn überhaupt, was soll ich aufschreiben? Man kann doch nicht alles aufschreiben - selbst nicht das alles, was einem noch in die Erinnerung kommt. Es gibt Dinge, die so persönlich sind, daß man sie für andere nicht niederschreiben kann, ja nicht niederschreiben muß. Ich denke, jeder Mensch muß eine kleine Nische für sich behalten, in die ein anderer nicht eindringen darf. Den letzten Gedanken preisgeben müssen? Nein, wenn das sein müßte, schreibe ich lieber nichts auf.
Also will ich’s wagen. Jetzt, wo ich beginne, weiß ich selbst noch nicht, was dabei herauskommen wird. Deshalb lasse ich mich überraschen. Nur eins weiß ich: Ich habe weder die Absicht noch die Lust, mein gesamtes bisheriges Leben darzustellen. Deshalb beschränke ich mich auf den Teil meiner Kindheit und Jugend - gewissermaßen nur auf den Abschnitt, in dem ich noch frei war von einer eigenen Familie mit Ehefrau und Kindern, das Leben bis zur eigenen Hochzeit im Jahre 1956. Und eine Möglichkeit besteht ja immer noch, denke ich jetzt: Wenn es mir zwischendurch oder auch wenn ich glaube, alles aufgeschrieben zu haben, nicht mehr gefällt, was ich geschrieben habe, dann - ja dann kann ich alles wieder zerreißen oder verbrennen, damit niemand erfährt, wie es mir in meinem Leben ergangen ist.
Fange ich also an und betone, daß ich nur für mich, bestenfalls noch für meine Familie - Brüder und Schwestern, Kinder und Kindeskinder - schreiben werde. Alle übrigen werden sich dafür nicht interessieren; höchstens diejenigen, die ich als Freunde oder Bekannte erwähne. Vielleicht aber erfährt meine Ehefrau etwas, was sie noch nicht weiß; und das, obwohl sie schon 41 Jahre mit mir verheiratet ist.
* * *
Herkunft und erste Wahrnehmungen
(2) - Wo liegen meine Wurzeln? Wo stand meine Wiege? Wo ist meine Heimat? Meine Eltern. Wer waren sie? Wo kommen sie her?
Die männliche Linie meines Vaters stammt aus Westfalen, die mütterliche vom Hunsrück. Viel weiß ich über diese Familien nicht. Zwar habe ich die Großeltern väterlicherseits
Großvater Heinrich Brieler
(1876 - 1941)
Großmutter Barbara Brieler
(1882 - 1953)
und sogar noch die Urgroßmutter (die Mutter der Großmutter Barbara Brieler) gekannt; sie war nach dem Tode ihres Mannes noch einmal mit Joseph Fuhshöller verheiratet, aber mein Vater hat nie viel von seiner Familie gesprochen.
Handwerker waren die, die aus Westfalen kamen. Drechsler, Schreiner, und mein Großvater war Emaillebrenner. Die Hunsrücker scheinen eine ganz einfache Familie gewesen zu sein. Fabrikarbeiter und Tagelöhner weisen die Ahnenzeugnisse aus. Immerhin gab es in dieser Linie einen Schiffer.
Eine beneidenswerte Kindheit hat mein Vater sicher nicht gehabt. Da waren zwei Brüder und zwei Schwestern. Mein Vater war das älteste von fünf Kindern. Der ältere der beiden Brüder starb als Kind an einer Hirnhautentzündung, der zweite fiel in Rußland im 2. Weltkrieg. In Thüringen hat die Familie wohl einmal kurze Zeit gewohnt; mein Vater erwähnte es hin und wieder. Die älteste seiner beiden Schwestern ist auch dort geboren. Als mein Vater aus der Volksschule entlassen wurde, mußte er Geld verdienen, wie es damals hieß. Einen Beruf zu erlernen, war ihm nicht vergönnt.
Die Linie meines Großvaters mütterlicherseits
Großvater
Peter Decrouppe
(1869 - 1947)
stammt ebenfalls aus dem Hunsrück; ein Lehrer war unter ihnen. Die weiteren Vorfahren kommen wohl - wie sich auch aus dem Namen ergibt - aus Belgien, Wallonien - nicht aus Frankreich, wie ursprünglich angenommen worden ist. Die Großmutter mütterlicherseits war mit allen ihren Vorfahren in der Eifel - in Reifferscheid bei Adenau - beheimatet, alles Landwirte und Handwerker, Schreiner, Stellmacher (meine Vorfahren hatten wohl überwiegend einen Hang zu Holz-Berufen, was vielleicht auch erklärt, daß ich selbst gerne mit dem Werkstoff Holz arbeite). Meinen Großvater habe ich nur einmal gesehen; es muß mitte der dreißiger Jahre gewesen sein, als ich mit meiner Mutter auf Rosas Kommunionfeier gewesen bin, einer Nichte und dem Patenkind meiner Mutter.
Josef Langweiler (1844 - 1904). Er ist der Großvater meiner Mutter mütterlicherseits. Er war Stellmacher in Reifferscheid. Es ist das älteste Bild meiner Vorfahren.
Meine Mutter hat eine miserable Kindheit gehabt. Ihr Vater war als Schmiedemeister in Hilberath bei Meckenheim selbständig. Ihre Mutter war die zweite Frau dieses Mannes. Er hatte sie geheiratet, nachdem die erste Frau bei ihrem zweiten Kind im Wochenbett gestorben war. Meine Mutter war das erste Kind der zweiten Frau und ein Jahr alt, als auch diese bei ihrem zweiten Kind*) wiederum im Wochenbett verstarb.
Was mag in einem Mann vorgehen, der nach vierjähriger Ehe vier Kinder hat aber keine Frau mehr! In dem Handwerksbetrieb, in dem es in der bäuerlichen Umgebung von morgens bis abends Arbeit in Fülle gab und nebenher selbst noch eine kleine Landwirtschaft betrieben werden mußte, war niemand, der den Säugling und das einjährige Mädchen, meine Mutter, versorgen konnte. Beide Kinder kamen in die Obhut ihrer Großmutter nach Reifferscheid. Dort wuchs meine Mutter auf bis zum 14. Lebensjahr und zur Schulentlassung. Unmittelbar danach starb die Großmutter nach einem jahrelangen Krankenlager. Sie muß eine gute Frau gewesen sein und nahm die beiden Kinder immer gegenüber ihrer eigenen Tochter, der Tante Apollonia, in Schutz, wenn diese ärgerlich über die Kinder war. Meine Mutter hat in ihrem ganzen Leben immer wieder von ihrer Großmutter erzählt und deren Sprüche - Weisheiten - zitiert. Die Kinder fanden nach ihrer Schulentlassung, weg von „zuhause", eine Arbeit bei Bauern - sie gingen in Stellung, sagte man damals - und waren fortan auf sich allein gestellt. Mein Großvater ist noch eine dritte Ehe eingegangen. Mit dieser Frau hatte er zwölf Kinder, und sie überlebte ihn um viele Jahre.

*) (Onkel Peter * 07.08.1904, + 30.04.1989 - der einzige leibliche Bruder meiner Mutter
im Alter von etwa 20 Jahren)
Wer also waren meine Eltern? Es waren gute, fleißige, strebsame, fürsorgliche und mitfühlende aber arme Leute aus einfachen Familien. Ich habe meine Herkunft nie als Makel empfunden, nie und nirgends mein Zuhause verleugnet und - wenn sich die Gelegenheit ergeben hat - immer mit Stolz von meinen Eltern und deren persönlichen Leistungen erzählt. Was sie in ihrem ganzen Leben unter fast immer wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen für ihre Kinder getan haben, was sie - und wie sie es - angestellt haben, daß anständige Menschen - so pflegte man immer zu sagen - aus ihnen wurden, verdient höchsten Respekt. Vor allem unsere Mutter hatte die Ideen und das Durchsetzungsvermögen unter Zurückstellung fast aller persönlichen Bedürfnisse. Vater war der Arbeiter, der Schaffer, der - obwohl er nach einem arbeitsreichen und regelmäßig langen Tag oft müde war - niemals aufhörte, für seine Familie zu sorgen - manchmal bis zur Selbstaufgabe. Erst als Vater in Rente ging - er war so um die sechzig und nach vielen Jahren als Hilfsarbeiter am Bau, zuletzt bei der Eisenbahn am Bahnhof Koblenz-Lützel beschäftigt - und Mutter ebenfalls ab sechzig eine kleine Rente bezog, ging es den beiden wirtschaftlich besser, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, daß sie für ihre inzwischen volljährigen Kinder nicht mehr unmittelbar sorgen mußten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die ältesten vier Kinder verheiratet. Ludwig, der jüngste Sohn, heiratete später; Bernhard blieb bis zu seinem Tod im Jahre 1990 unverheiratet.
 
Vater Peter Brieler (1903 - 1982)
Mutter Gertrud Brieler (1903 - 1989)
Es ist anzunehmen, daß sie sich gefreut haben - meine Eltern Peter und Gertrud, als ich knapp zehn Monate nach ihrer Hochzeit in Neuendorf auf der Schanz - so hieß im Volksmund die obere Hochstraße, in der sich die erste Wohnung meiner Eltern befand - unter der fachkundigen Assistenz von Frau Imhof, der Hebamme, die auch half, alle meine anderen Geschwister zur Welt zu bringen, das Licht der Welt erblickte.
(ich selbst mit fünf Jahren)
Erblickte ist nur sinnbildlich zu verstehen; denn ob ich in dem Moment wirklich etwas erblickte, ist sehr zu bezweifeln. Immerhin ist wahrscheinlich, daß ich als erstes meine Mutter wahrnahm, die sich um mich sorgte im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar deshalb, weil mein Vater zu dieser Zeit arbeitslos war. Er teilte damit das Schicksal vieler tausend (oder waren es millionen?) Menschen nach dem von Deutschland verlorenen Ersten Weltkrieg mit den Auswirkungen des Versailler Vertrages. Die junge Familie mußte von der Arbeitslosen-Unterstützung leben - man ging „stempeln", hieß das. Und das wiederum war wörtlich zu nehmen; denn die Arbeitslosen mußten sich jeden Tag - außer sonntags - beim Arbeitsamt vorstellen. In ihrem Arbeitslosen-Ausweis wurde dann ihr persönliches Erscheinen durch einen Stempel bescheinigt. Die Unterstützung reichte natürlich hinten und vorne nicht. Mein Vater versuchte - wie das auch heute Arbeitslose noch tun - etwas hinzuzuverdienen. Zeitweise gelang dies in der Nachbarschaft bei Glöckners Albert, einem Bauer, der auch einen Kohlenhandel betrieb.
Von all dem habe ich damals nichts wahrgenommen. Aber meine Mutter erzählte später hin und wieder, wie arm es damals war, und daß Vater bei der Nebenbeschäftigung außer dem Essen zwei Reichsmark am Tag verdient habe.
Neuendorf ist nicht nur mein Geburts-, sondern auch mein Heimatort. Obwohl ich seit 1961 mit meiner eigenen Familie in Neuhäusel im vorderen Westerwald glücklich und zufrieden lebe, bin ich meinem Geburtsort stets verbunden geblieben. Neuendorf ist der nördliche Vorort von Koblenz an der linken Rheinseite, von Koblenz nur durch die Mosel getrennt, die am Deutschen Eck aus den Vogesen kommend in den Rhein fließt. Eine herrliche Lage am Zusammenfluß von Rhein und Mosel, direkt am Rhein gelegen mit einem kleinen Wäldchen, das zum Schutz vor Hochwasser und Treibeis angelegt worden war, und wo sich heute - direkt vor der berühmten Festung Ehrenbreitstein und dem Deutschen Eck (von 1948 bis 1990 Mahnmal der Deutschen Einheit) - wohl einer der schönsten Campingplätze Deutschlands befindet. Hier gab es schon in den dreißiger Jahren ein Freibad. Damals konnte man noch bedenkenlos im Rhein und in der Mosel baden. Neuendorf, das Dorf der ehemaligen Flößer. Noch in den fünfziger Jahren trieben Flöße, die vor allem im Schwarzwald zusammengestellt worden waren, rheinabwärts gen Holland. Was war das ein Spaß, aber nicht ungefährlich, als Kind auf den Flößen herumzutoben, wenn diese abends vor dem Neuendorfer Ufer festmachten, um die Nacht zu verbringen. Und was habe ich als Kind und später als Jugendlicher alles in Neuendorf erlebt; ich werde noch darauf zurückkommen
Meine Erlebnisse in der Anfangszeit meines Lebens sind für mich kaum in Erinnerung. An unsere erste Wohnung bei der Familie Komes - der älteste Sohn dieser Familie hatte einen Taubenschlag, was eigentlich nichts besonderes ist (viele Familien hatten in Neuendorf einen Taubenschlag) - kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ich erwähne es nur deshalb, weil meine Mutter später erzählte, daß ich - nachdem ich mit neun Monaten begonnen hätte zu laufen - mit elf Monaten versucht habe, über die Leiter in diesen Schlag zu gelangen.
Die großen Rheinwiesen sind das Erste, was mir nach heutiger Betrachtung aufgefallen ist. Diese Wiesen gibt es immer noch, aber das, was damals da geschah, wird nicht mehr praktiziert. Die Frauen haben dort ihre Wäsche in der Sonne gebleicht.

(Neuendorf, Rheinpromenade, im Jahre 1951)
Bis nach dem zweiten Weltkrieg hatten die Frauen es schwerer als heute, als es noch keine Waschmaschinen gab, und die Wäsche auf dem Brett gebürstet oder in der Wanne gestampft werden mußte. Anschließend wurde sie zum Rhein gebracht und auf der Wiese ausgebreitet. Sie wurde mehrmals täglich begossen, aber nicht mit Wasser aus einer - wie mancher heute denken mag - dort installierten Leitung, nein, mit Rheinwasser.
Um es aus dem Rhein zu entnehmen, ging man zu dem in der Nähe befindlichen Anlegesteg der Fähre; diese war ein großer Holznachen, der durch Muskelkraft des Fährmanns mehrmals am Tage nach Bedarf nach Urbar auf der anderen Rheinseite und wieder zurück gerudert werden mußte.
(Brigitte, *1933 im Alter von 19 Jahren)
Wann meine Eltern mit mir (ob auch meine Schwester Brigitte schon geboren war, weiß ich nicht) in die Handwerkerstraße, direkt gegenüber der Volksschule, umzogen, kann ich heute nicht mehr sagen. Aber dort wuchsen meine Wahrnehmungsfähigkeit und mein Bewußtsein. Hier wurde ich mit sechs Jahren auch eingeschult.
* * *
Vor dem Umzug in's eigene Haus
(3) - An den Tag der Einschulung kann ich mich noch erinnern. Aber bis dahin dauerte es noch einige Jahre. Wir wohnten also nun in der Handwerkerstraße - im Anbau eines Mehrfamilienhauses der Witwe Andres. Sie war der Prototyp eines Vermieters - unnahbar, streng. Keiner der Mieter konnte sie leiden. Fünf Mietparteien führten täglich einen aussichtslosen Kampf gegen sie - natürlich auch meine Eltern. Zwei Höfe gab es bei diesem Haus, und es ist nachvollziehbar, daß die Mieter auch hin und wieder einmal das Bedürfnis gehabt haben, auf diesen Höfen etwas abzustellen. Aber weit gefehlt. Das war nicht zulässig. In diesem Punkt war die Witwe Andres unnachsichtig. Meinen Vater traf dies um so mehr, als wir einen Handwagen - einen sogenannten Leiterwagen - besaßen, der jedoch im Keller aufbewahrt werden mußte, was deshalb besonders schwierig war, weil der Wagen bei jeder Benutzung aus dem Keller herausgenommen und nachher wieder dorthin gebracht werden mußte. Dies war aber nur möglich, wenn man jedesmal die Räder abmontierte und den Wagen gewissermaßen in Stücken in den Keller trug, der ohnehin viel zu beengt war.
Die Wohnung war auch nicht berauschend. Trotzdem wird sie besser gewesen sein als die bisherige in der Hochstraße. Die neue Wohnung bestand aus vier verhältnismäßig kleinen, etwa quadratischen Zimmern, die hintereinander lagen. Wenn man das letzte Zimmer erreichen wollte, mußte man von der Küche aus (die war das erste Zimmer) durch zwei weitere hindurchgehen. Ein Bad gab es nicht; das war bei Mietwohnungen damals auch nicht üblich. Die Toilette lag außerhalb an der Außentreppe, die überdacht war. Nur über diese konnte man die Wohnung erreichen.
Hier wohnten wir also bis zum Jahre 1938. Als wir aus dieser Wohnung auszogen, war die Familie auf sechs Personen angewachsen; denn im Jahre 1935 kam meine Schwester Trudel und im Jahre 1937 mein Bruder Bernhard hinzu. Für diese Familie war die Wohnung denn doch zu klein geworden.
 
(Trudel, * 1935,
im Alter von vier Jahren)
(Bernhard, 1937 - 1990,
im Alter von sieben Jahren)
Ich hatte mich mit einem Jungen angefreundet, der ebenfalls im Haus der Witwe Andres wohnte. Karl hieß er; er war ein Jahr älter als ich, aber wir spielten jeden Tag miteinander. In der Handwerkerstraße gab es noch andere Kinder, die etwas älter waren als Karl und ich. Mit denen durften wir auch spielen. Sie stifteten uns manchmal zu Dingen an, die man gemeinhin als Schabernack oder Unartigkeiten bezeichnen kann. Bei solchen Streichen waren Karl und ich oft arm dran; denn wenn die Streiche offenbar wurden, waren es nicht die Großen, sondern jedesmal wir gewesen, die dafür den Kopf hinhalten mußten. In der Nachbarschaft gab es auch einen Steinmetzbetrieb. Hier schauten wir oft zu, wie die Handwerker die Grabsteine bearbeiteten mit dicken, runden Holzhämmern, wie wir zuvor noch keine gesehen hatten. Eines Tages schenkte uns der Handwerker einen solchen abgearbeiteten und deshalb für den Betrieb nicht mehr nutzbaren Hammer. Aber wir konnten natürlich vieles damit anfangen. Welcher kleine Junge hatte schon so einen Hammer!
Und eine Baustelle gab es in der Handwerkerstraße. Hier wurde ein neues Haus errichtet. Es erhielt die Hausnummer drei. Abgesehen davon, daß Karl und ich uns hier manchmal mit einem kleinen Eimer Sand zum spielen holen durften, ist dieses Haus für mich deshalb von besonderer Bedeutung, weil hier nicht nur ein Junge einzog, Gerd hieß er, der mit mir im selben Schuljahr war, sondern der Jahre später auch einer meiner engsten Freunde wurde. Viele Abende haben wir in diesem Haus verbracht und Skat gespielt. Gerds Mutter hat oft mitgespielt, wenn uns der dritte Mann gefehlt hat. Aber nicht nur das. Nach meiner Eheschließung fand ich in diesem Haus auch die zweite Wohnung. Alles das konnte ich aber damals - vor meiner Einschulung - noch nicht wissen.
Mein Vater arbeitete zu dieser Zeit am Bau. Später hat er mir erzählt, daß er bei der Errichtung des Stadions Koblenz-Oberwerth und der neuen Moselbrücke - die hieß damals „Adolf-Hitler-Brücke" - mitgearbeitet hat. Nach der Arbeit ging er immer in den Garten. Dort, am Wallersheimer Weg, pflanzte er Kartoffeln, Gemüse, Bohnen und Salat an, wodurch sich die Familie besser ernähren konnte; denn das Einkommen meines Vaters war gering. Oft fuhr ich mit ihm in den Garten und durfte dabei im Leiterwagen sitzen. Das ging aber nicht immer. Vor allem dann nicht, wenn mein Vater für die Bodenverbesserung und Düngung durch die Ortsstraßen fuhr und den auf der Straße liegenden Pferdedung aufkehrte. Damals gab es genug davon. Neuendorf war ein Bauerndorf. 22 Vollerwerbsbetriebe gab es zu dieser Zeit, wenn ich mich recht erinnere. Und fast alle Bauern fuhren mit Pferden, nur drei oder vier hatten Kühe als Gespann. Meines Wissens gibt es heute nicht einen einzigen Bauer mehr. Damals aber - ich erwähnte es bereits im vorherigen Kapitel - hat mein Vater manchmal auch bei einem Bauer ausgeholfen. Mit Pferden, Ochsen oder Kühen konnte er umgehen. Als Heranwachsender hatte er - wie er später oft erzählte - bei Bauern gearbeitet und dort auch seine Frau - meine Mutter - kennen gelernt. Bei den Großbauern Brünagel und Steinheuer in der Grafschaft bei Meckenheim hatte meine Mutter ihre ersten Stellen gefunden; hier hat sie als Magd gearbeitet, in der Küche kochen gelernt und sonst auch alle Arbeiten verrichten müssen, die auf einem Bauernhof anfallen. Bei Sauerborns hatte mein Vater überwiegend gearbeitet. Hier hat er wohl ein gutes Verhältnis gehabt; denn später - noch in den sechziger Jahren - ist mein Vater oft mit dem Fahrrad nach Heimbach-Weis gefahren, wo Sauerborns schon in den dreißiger Jahren einen neuen Hof übernommen hatten. Kennen gelernt aber haben sich meine Eltern beim Bauer Lobenthal in Wallersheim. Dieser Bauer hat später den Hof Kirschheimersborn über Bad Ems übernommen.

(Hofgut "Kirschheimersborn" über Bad Ems um etwa 1930
Meine Eltern waren dabei, als der gesamte Betrieb in eigener Regie mit Pferdefuhrwerk von Wallersheim auf die Taunushöhe über Bad Ems verlegt worden ist. Lobenthals sind aber auf diesem Hof bankrott gegangen, und meine Eltern haben ihre Stelle verloren. Meine Mutter hat sodann im Café Haymann in Koblenz - einem renommierten Café in der Löhrstraße, das es heute jedoch nicht mehr gibt - in der Küche gearbeitet. Bei freier Kost und Logis habe sie dort - erzählte sie - im Monat 50 Reichsmark verdient. Soviel hätte sie bis dahin noch nirgends erhalten. Und mein Vater hat vor seiner Ehe auch bei einem Müllerbetrieb in Ehrenbreitstein als Fuhrmann gearbeitet. Hierfür ist er gezielt ausgebildet worden. Er besaß schon einen „Führerschein" für Pferdefuhrwerke. Und den brauchte er, weil er das Mehl mit dem Fuhrwerk, gezogen von zwei Pferden, über Land, meist auf den vorderen Westerwald bis nach Montabaur, fuhr. Da hatten die Pferde eine schwere Last zu ziehen - aber mein Vater auch zu tragen. Zehn Pfennig - erzählte er - habe er Trinkgeld für jeden Sack Mehl bekommen, den er auf dem Rücken abgeladen habe. Und jeder Sack habe zwei Zentner gewogen.
Doch zurück zu Neuendorf. Nicht nur Bauern gibt es heute nicht mehr. Wenn ich zurückblicke, ertappe ich mich dabei, wie ich versuche aufzuzählen, wie viele Lebensmittelgeschäfte oder Bäckereien oder Metzgereien es damals in Neuendorf gegeben hat. Immerhin hatte Neuendorf kurz vor dem Krieg schon fast 6000 Einwohner. Ob ich noch alles lückenlos zusammen bekomme? Also: Es gab 22 Lebensmittelgeschäfte, 14 Bäckereien, sechs Metzgereien, sechs Wirtshäuser, fünf Friseure, vier Gärtnereien und eine Drogerie. Eine Apotheke gab es nicht; Arzneien mußten die Neuendorfer in Lützel am Schüllerplatz in der Engel-Apotheke kaufen; auch die nächste Zweigstelle der Stadtsparkasse Koblenz befand sich in Lützel.
Aus der Zeit vor meiner Einschulung erinnere ich mich noch an das sonntägliche Kirchen-Ritual. Meine Mutter war eine fromme Frau, und der Sonntag war ihr heilig. Das bedeutete, daß am Sonntag morgens die Messe, nachmittags die Christenlehre und abends die Andacht besucht werden mußte. Ich weiß nicht, ob es heute noch Menschen gibt, die so fromm sind. Andererseits hat der oftmalige Kirchenbesuch aber auch nicht geschadet. Trotzdem ist meine Mutter bei aller Frömmigkeit, die sie offenbar von ihrer Großmutter übernommen hat, nie kirchenhörig gewesen. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Aber es gab auch etwas Angenehmes am Sonntag: Bei Bernardys in der Nachbarschaft gab es sonntags Speiseeis. Meine Eltern gaben mir dafür immer fünf Pfennige; dafür bekam man schon eine Waffel mit Eis. Viel war es zwar nicht, aber wir haben uns trotzdem darüber gefreut. Und außerdem hatten meine Eltern ja sowieso nicht so viel Geld übrig.
In heller Aufregung erlebte ich meine Mutter einmal - es muß im Sommer 1938 gewesen sein, als sie völlig aufgelöst, meinen einjährigen Bruder Bernhard im Arm, die Wohnungstreppe hinunter rannte, um zum Arzt zu kommen. Ich wußte zunächst nicht, was geschehen war. Als sie zurückkehrte, erfuhr ich, daß Bernhard Essig-Essenz getrunken, sich den Rachen verätzt hatte und bei den einsetzenden Krämpfen beinahe erstickt wäre. Ostern 1938 erfolgte die Einschulung in die Volksschule Koblenz-Neuendorf. Unser Klassenlehrer war Herr Thelen.
Er setzte mich in die hinterste Reihe. Es gab Bänke mit Klappsitzen und Klapptischen. Jeweils vier Kinder saßen in einer Reihe; und zwei solcher Reihen standen - getrennt durch einen Gang - nebeneinander. Auf der einen Seite saßen die Mädchen, auf der anderen die Jungen. Ein Klassen-Foto wurde auch gemacht; auf der großen Treppe, die zum Schulhof führte.
(Die Einschulung 1938 mit Lehrer Thelen)
Im selben Jahr sind wir noch einmal umgezogen. Meine Eltern hatten ein altes, kleines Bauernanwesen mit Stall und Heuschober in der Owersgasse von den Erben Ower gekauft. Um die 3000 Reichsmark hat dieses Anwesen gekostet. Natürlich hatten meine Eltern nicht so viel Geld. Onkel Peter - der Bruder meiner Mutter - hatte ihnen den fehlenden Betrag geliehen. Nach Jahren habe ich mich oft gefragt, wie meine Eltern bei der bekannten Armut überhaupt hatten etwas sparen können. Meine Eltern wollten bei der großen Familie aber nicht immer in Miete wohnen und sich mehr oder weniger ständig mit den Vermietern herumärgern müssen. Hier konnte ihnen niemand mehr reinreden.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Kindheit vor dem Bewßtsein des Krieges
(4) - Wir hatten ein eigenes Haus! Was das für meine Eltern bedeutet haben mag, konnte ich erst viele Jahre später ermessen, als ich mit Marlies, meiner Ehefrau, im Jahre 1961 in Neuhäusel ein eigenes Haus baute. Und was haben sich wohl die Leute die Köpfe zerrissen! Ausgerechnet die, die sowieso nichts hatten außer vier Kindern, haben ein Haus gekauft. Aber meinen Eltern konnte es egal sein. Sie hatten es, und das war wichtig. Hier konnten sie machen, was sie wollten. Nach dem, was meine Mutter mir erzählte, gab es wahrscheinlich nur wenige in Neuendorf, die der Familie das gegönnt haben.
Auch für uns Kinder war das natürlich ein völlig neues Gefühl. Wir mußten nicht mehr vor Frau Andres ducken; wir konnten uns frei entfalten. Und die Nähe zum Rhein! Es waren ja nur ein paar Meter.
Das Haus selbst - na ja, es war ein altes Haus. Im Erdgeschoß gab es die Küche, eine Stube und eine Kammer. In den beiden oberen Etagen lagen die Schlafzimmer. Ein Bad gab es auch hier nicht (welcher Bauer hatte schon ein Bad?), und die Toilette lag auch außerhalb des Wohngebäudes; sie war im Hof - ein „Plumps-Klo", was den Vorteil hatte, Gülle zu produzieren, die mein Vater für den Garten gut gebrauchen konnte. Im Stall, da wo früher die Kühe standen, baute mein Vater einen Hühnerstall mit Nestern. Auch Boxen für Kaninchen baute er dort hinein. Und dann bekamen wir sie: Hühner und Kaninchen. Damit brauchten wir keine Eier mehr zu kaufen, und hin und wieder gab es sonntags einen Braten. Hühner und Kaninchen schlachtete mein Vater selbst. Der Hof war etwas Besonderes. Er war gepflastert. Aber nicht mit herkömmlichen Granit- oder Basaltsteinen, sondern mit Kieselsteinen - große, runde, weiße und bunte Steine. Das war keine ebene Oberfläche im Hof, und es war etwas beschwerlich, darüber zu gehen. Solche Höfe fand man damals in vielen bäuerlichen Anwesen. Meinen Eltern mag das auch nicht besonders gefallen zu haben; denn nach und nach wurde das geändert. Mein Vater legte eine Regenrinne an und belegte den ganzen Hof mit Steinplatten und Ziegelsteinen. In der hinteren Ecke des Hofes war der Misthaufen. Die verbrauchte Einstreu der Hühner und Kaninchen wurde hier zwischengelagert - zur Freude der Hühner - und später als wichtigen Dünger ebenfalls in den Garten gefahren.
Parallel mit dieser wohnlichen Entwicklung verlief auch die berufliche meines Vaters. Es gelang ihm, als Arbeiter bei der damaligen Deutschen Reichsbahn eine Stelle zu finden. Das war ein Glücksfall für die Familie; denn jetzt erhielt er neben seinem Lohn auch Kindergeld, was damals nur von staatlichen und sonstigen öffentlichen Arbeitgebern gezahlt wurde. Der Stellenwechsel bedeutete eine erhebliche wirtschaftliche Verbesserung, zumal ein Jahr später das fünfte Kind, meine Schwester Therese, geboren wurde.

(Schwester Therese, * 1939, im Alter von 18 Jahren)
Der Arbeitsplatz meines Vaters war beim Bahnhof Ehrenbreitstein. Dorthin fuhr er täglich mit dem Fahrrad. Zunächst arbeitete er im Streckendienst - in der Rotte, wie es hieß - und bedeutete Gleisbau und -unterhaltung. Kurze Zeit später wurde er aber für die Tätigkeit in einem Stellwerk ausgebildet. Und so kam er in die Stellwerke Ehrenbreitstein-Nord oder Ehrenbreitstein-Süd. Hier war die Arbeit körperlich nicht mehr so schwer - aber er hatte eine größere Verantwortung zu tragen. Wenn mein Vater sonntags Dienst hatte, habe ich ihm später immer das Essen gebracht. Das war ein weiter Weg, meistens zu Fuß über die Schiffbrücke in Koblenz, besonders, wenn er im Stellwerk Ehrenbreitstein-Nord arbeitete. Das lag auf halbem Weg nach Urbar, in unmittelbarer Nähe des Felsens, einem bekannten Merkmal zwischen Ehrenbreitstein und Urbar. Dieses Stellwerk konnte man vom Neuendorfer Rheinufer gut sehen, es lag direkt gegenüber dem Sportplatz und war höchstens 300 Meter (über den Rhein) entfernt. Zu Fuß mußte ich dorthin aber fast vier Kilometer zurücklegen - für eine Strecke.
Die Schiffbrücke in Koblenz war etwas ganz Besonderes - ja, ich glaube sogar etwas Einmaliges. Es war eine Ponton-Brücke, mit Holzbohlen belegt und „ausfahrbar". Wenn Schiffe passieren wollten, mußte die Brücke ausgefahren werden, damit ein Durchlaß entstand, durch den die Schiffe fahren konnten. Die notwendigen Motoren hierfür waren in der Brücke eingebaut, so daß sie sich selbst öffnen konnte. In diesem Fall wurde die Brücke für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Die Sperrung dauerte manchmal eine halbe Stunde, dann nämlich, wenn ein Schleppzug rheinaufwärts fuhr. Ein Schleppzug bestand meistens aus einem Raddampfer mit bis zu sechs Schleppkähnen. Wenn ich meinem Vater das Essen brachte, war es für mich besonders ärgerlich, wenn gerade in dieser Zeit die Schiffbrücke für den Verkehr geschlossen war. Das bedeutete eine Wartezeit - und außerdem wurde das Essen kalt.
Die politischen Ereignisse bekam ich als Sechsjähriger natürlich nur am Rande mit. Einmal im Monat kam sonntags (dem sogenannten Eintopfsonntag) ein Mann in brauner Uniform und sammelte Geld für das Winterhilfswerk. Kurze Zeit nach der Geburt meiner Schwester Therese hieß es „Es ist Krieg". Ich hatte keine Vorstellung, was das wirklich bedeutete. Vorläufig betraf uns das auch nicht unmittelbar. Man sagte, die Väter in kinderreichen Familien müßten nicht Soldat werden, und bei uns gab es ja schon fünf Kinder. Aber irgendwann hat es meinen Vater doch erwischt. Es wird im Herbst 1939 gewesen sein. Er wurde zwar nicht zur Wehrmacht eingezogen, sondern zum Reichsarbeitsdienst. Das war, wie ich später erfuhr, eine militärähnliche Organisation, die vor allem Bau- und Pionierarbeiten verrichtete. Mit dieser Organisation - sie wurde RAD abgekürzt - zog mein Vater an die deutsche Westgrenze zum Ausbau des sogenannten Westwalls, einer Grenzbefestigung gegen den damaligen Erzfeind und Nachbarn Frankreich. Doch nach ein paar Monaten war mein Vater wieder zu Hause. Vorher gab es für mich noch ein persönliches Ereignis. Auf Drängen des Neuendorfer Pastors Dr. Johannes Schlich feierte ich Erstkommunion. Mein Vater konnte an diesem Fest wegen seiner Tätigkeit am Westwall nicht teilnehmen. Urlaub bekam er nicht. Meine Mutter hatte Kuchen gebacken, und viele Leute kamen, um zu gratulieren. Geld haben sie mir gegeben und Geschenke. Noch im Frühjahr 1940 - ich war gerade acht Jahre alt geworden - wurde ich Meßdiener.
Meine freie Zeit verbrachte ich meistens am Rhein, obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht schwimmen konnte. Spielkameraden gab es dort genug, einige davon waren in meiner Klasse. Wir bauten mit den dicken Steinen im Flußbett Häfen, schnitzten kleine Boote - teilweise mit Segelaufsatz - und spielten das, was wir auf dem Rhein täglich sahen. Große Raddampfer, die bis zu sechs Schiffen, meistens vollbeladen mit Kohle, hinter sich her zogen, und auch große weiße Raddampfer für den Personen- und Ausflugsverkehr. Wir kannten sie alle, die Schiffahrtslinien wie Damco, Raab-Karcher, Franz Haniel, Matthias oder Hugo Stinnes und die Namen der Ausflugsschiffe wie Goethe (dieses Schiff fährt heute noch), Vaterland, Rheingold oder Mainz.
Eine herrliche, andere Spielmöglichkeit ergab sich auch in den Kribben, so hieß das in Neuendorf, obwohl es das niederdeutsche Wort für Buhnen ist. Diese befanden sich etwa zwei Kilometer rheinabwärts zwischen Wallersheim und Kesselheim - dort, wo sich heute die Einfahrt zum Koblenzer Industriehafen befindet. Zwischen den einzelnen Buhnen, die bis zu 20 Meter in den Rhein hinein ragten, gab es warmes, seichtes Wasser, hervorragend geeignet zum Baden, was im Rhein selbst an dieser Stelle wegen der starken Strömung nicht möglich war. Auch hier konnten wir mit selbstgemachten Schiffchen spielen. Aber auch „auf dem Trockenen" gab es tolle Möglichkeiten. Hier war es wie im Urwald. Bis zu zwei Meter hohes Schilf und Rohr, fast undurchdringlich. Dies war hervorragend geeignet, um versteckte Hütten und Unterkünfte zu bauen - ein idealer Platz zum Indianer-Spiel. Und im Herbst gab es noch etwas Besonderes: Walnüsse. In den Gemarkungen Kesselheim und Wallersheim standen ganz in der Nähe viele riesige Nußbäume, von denen wir uns, sobald die Früchte reif waren - manchmal auch früher, weil wir es kaum erwarten konnten - stets bedienten.
Am Rhein konnten die Kinder im Winter ebenso schön spielen wie im Sommer. Was gab es doch für herrliche Winter in dieser Zeit. Natürlich waren sie sehr kalt, und lange haben sie gedauert. Aber es hat Schnee gegeben, viel Schnee - sogar in Neuendorf, nicht nur auf den Höhen rund um Koblenz. Auf den Rheinwiesen war dann ein großes Gedränge. Alle Kinder versammelten sich dort mit Schlitten und fuhren bis ins Flußbett hinein, bis unmittelbar an das Wasser. Wenn dieses gefroren war, konnte man noch weiter fahren. Zum Schlittschuhlaufen gingen wir nach dem Krieg in die bereits zitierten Kribben. Zwischen den Buhnen war das Eis hervorragend eben und glatt, und die Gefahr des Einbrechens war so gut wie ausgeschlossen. Manchmal waren die Winter so kalt, daß der Rhein etwa 30 bis 40 Meter zur Mitte hin zugefroren war; etwas, was man heute überhaupt nicht mehr zu sehen bekommt. Die größeren Kinder, aber auch Erwachsene gingen dann mit Schlittschuhen auf dieses Eis. Setzte jedoch später Tauwetter ein, wurde das Eis brüchig, und man mußte sehr vorsichtig sein, wollte man nicht einbrechen. Das war etwas, was hin und wieder geschah. Auch meinem Vater ist das in seiner Jugend geschehen. Im Winter total eingebrochen. Bis zur Brust hat er im eiskalten Wasser gestanden. Schnell nach Hause gelaufen, erzählte er, und damit seine Mutter nichts gemerkt hätte, hätte er seine nassen Sachen zum trocknen in den Kleiderschrank gehängt. Natürlich sei es aber nicht unbemerkt geblieben. Ich selbst hatte einen Schlitten schon zu Weihnachten bekommen, als wir noch in der Handwerkerstraße wohnten; es war ein gebrauchter Schlitten - wie ich später bemerkt habe, den mein Vater, damit er wie neu aussehen sollte, rotbraun angestrichen hatte. Der Winter 1942-43 war besonders kalt; bis in den April hat er gedauert. Viel Schnee war gefallen, der sich im Laufe der Monate immer mehr verdichtete und zu Eis wurde. Als es endlich zu tauen begann, hatten wir zu Hause im Hof eine Eisschicht von mehr als zehn Zentimeter Dicke. Diese Schicht habe ich, um den Hof schneller wieder von Eis frei zu bekommen, mit dem Beil abgeschlagen.
Es war eine in meiner Erinnerung schöne Zeit bis zur Verschärfung des Krieges. Dann war die Unbeschwertheit dahin.

(Onkel Toni, 1913 - 1942)
Zuvor gab es noch zwei Sterbefälle in der Familie. Im Juni 1942 fiel Onkel Toni, der jüngste Bruder meines Vaters, im Rußland-Feldzug beim Aufmarsch in Richtung Leningrad, heute wieder St. Petersburg. Er war 29 Jahre alt und fand sein Grab auf einem Soldatenfriedhof in der Nähe von Staraja Russa, südlich des Ilmensees.
Zuvor war schon mein Großvater, der Vater meines Vaters, im September 1941 im Alter von 65 Jahren verstorben. Onkel Toni mochte ich gut leiden, und es tat mir leid, daß er nicht mehr lebte. Vor meinem Großvater hatte ich immer großen Respekt. Er war etwas unnahbar. Mit einer Laubsäge konnte er hervorragend umgehen. Das tat er oft, weil er schon seit vielen Jahren wegen seiner Erkrankung invalide war und genügend Zeit dafür hatte. Er machte sehr schöne Dinge. Als bestes fand ich den in Laubsäge-Arbeiten nachgebildeten Kölner Dom mit einer Höhe von etwa einem Meter.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Der Krieg hat uns erreicht!
(5) - Von unmittelbaren Kriegsereignissen aufgeschreckt wurden die Menschen in Koblenz erstmals im April 1942 frühmorgens am Ostermontag, als die ersten Fliegerbomben auf die Stadt fielen. In der Schloßstraße waren das damalige Schloß-Café und einige andere Häuser zerstört worden. Im Laufe des Tages pilgerten hunderte von Schaulustigen dorthin, um sich das unbekannte Ereignis anzusehen. Ich weiß noch, daß ich mit meinem Vater auch dabei war. An Einzelheiten kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern. An diesem Tag werden die Koblenzer wohl einen Vorgeschmack davon bekommen haben, was ihnen im Laufe des Krieges noch bevorstand. Denn richtig los ging es erst zwei Jahre später, wiederum im April, als die Koblenzer Altstadt in Flammen stand - und auch die Goldgrube war schwer getroffen. Zur Bekämpfung des Feuers waren auf den Koblenzer Plätzen und Ringstraßen Feuerlöschteiche angelegt worden, zum Beispiel auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring (heute Friedrich-Ebert-Ring) oder auf dem Goebenplatz (heute Görresplatz).
Im April 1942, als die ersten Bomben auf Koblenz gefallen waren, wurde ich zehn Jahre alt. Das war deshalb von Bedeutung, als die Knaben mit diesem Alter zum Jungvolk „eingezogen" wurden. Dies war die Vorstufe der Hitler-Jugend, die man ihrerseits wiederum als Vorstufe des Militärs ansehen konnte. Die Jungen wurden in Gruppen zusammengestellt, und mehrere bildeten ein Fähnlein, dem ein Fähnleinführer vorstand. Alle Mitglieder des Jungvolks bekamen eine Uniform - natürlich mit braunem Hemd und einer kurzen schwarzen Hose. Es war gewissermaßen die „Klein-Uniform der SA". Jeden Samstag mußte das Jungvolk „antreten" - so nannte man das und bedeutete das Zusammenkommen auf dem Schulhof. Hier stand man in Reih’ und Glied - das wurde natürlich geübt, um nicht zu sagen gedrillt - vor dem Fähnleinführer. Auch wurden Lieder eingeübt und gesungen, zum Beispiel Es zittern die morschen Knochen... oder Wir lagen vor Madagaskar, natürlich auch das damalige Deutschland- und Horst-Wessel-Lied. Der „große Führer" und Vorsitzende der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSdAP), Adolf Hitler, ließ keine Möglichkeit aus, das Volk, das letztlich von ihm schmählich verraten wurde und sich täuschen ließ, auf seine Seite zu ziehen. Natürlich ist man nachher immer schlauer. Mit zehn Jahren habe ich dies natürlich nicht erkennen können. Ob meine Eltern es erkannt haben? Ich habe nie danach gefragt. Möglicherweise hätte ich auch nicht eine richtige Antwort bekommen. Denn wer gibt schon gerne zu, daß er sich hat täuschen lassen.
Das war die Zeit, in der nicht nur die Glocken von den Kirchtürmen geholt wurden, um Kanonen daraus zu machen; nein, es war auch die Zeit, in der ich einen neuen Freund fand. Reinhold hieß er. Er war mit seiner Mutter in das Nachbarhaus eingezogen und wohnte dort auf der Mansarde. Er kam aus dem Ruhrgebiet - von Essen. Von seinem Vater habe ich nie etwas gehört. Seine Mutter ging arbeiten. Sie half in der Küche in der Langemarck-Kaserne in Lützel. Mit Reinhold war ich oft zusammen. Wir hatten uns auch zusammen im Sportverein TuS 1911 Neuendorf angemeldet. Dort übten wir Tischtennis spielen. Während ich später - ich komme noch darauf zurück - zum Handballsport überwechselte, wurde Reinhold einer der besten Tischtennisspieler des Rheinlandes.
Ein Jahr später, genau am 16. August 1943, bin ich zur Deutschen Hauptschule in Koblenz gewechselt. Eigentlich konnten sich meine Eltern eine weiterführende Schule für ihre Kinder finanziell überhaupt nicht leisten, zumal im Sommer 1942 auch noch das sechste Kind, mein Bruder Ludwig, geboren worden war.
Meine Mutter hat es aber schließlich durchgesetzt, nachdem ihr und meinem Vater von meiner damaligen Klassenlehrerin Michels mit Nachdruck geraten worden war, mich in eine weiterführende Schule zu schicken. Nach dem Verständnis der heutigen Zeit ist die damalige Deutsche Hauptschule nicht vergleichbar mit der heutigen Hauptschule als Aufbaustufe der Grundschule. Vielmehr handelte es sich um die sogenannte Mittelschule, die unter dem Regime Hitlers einen anderen Namen erhielt, nach dem Krieg erneut in Mittelschule umgetauft wurde und wiederum Jahre später den Namen Realschule bekam. Vorteil der Deutschen Hauptschule war es, daß für die Kinder ein Schulgeld nicht entrichtet werden mußte, wie das bei Gymnasien und vorher auch bei der Mittelschule der Fall war.

(Bruder Ludwig, * 1942, im Alter von 20 Jahren)
So zog ich also mit meinen Neuendorfer Klassenfreunden Hans Kleemann, Hans Weller, Hans Zenz und Franz Klappa täglich - anfänglich per Straßenbahn - in die Hohenzollernstraße, wo das Schulgebäude stand. Sehr oft war auch Gerd Breidbach dabei, der jedoch eine Klasse weiter war. Es war derselbe Junge, dessen Eltern in der Handwerkerstraße vor einigen Jahren das Haus Nr. 3 bauten. Nur ein Jahr lang blieben wir in unserem Schulgebäude von Kriegseinwirkungen unbehelligt. Als aber im Juli 1944 das Gebäude bei einem Fliegerangriff durch Brandbomben teilweise zerstört worden war, wurde der Unterricht in dem Gebäude des damaligen Kaiserin-Augusta-Gymnasiums, heute Görresgymnasium, weitergeführt. Schon vorher - und verstärkt auch später noch - gab es Unterrichts-Ausfälle durch Fliegeralarme. Wenn die Sirenen heulten, wurden die Unterrichtsstunden abgebrochen; die Schüler mußten das Gebäude verlassen und die Luftschutzbunker oder -keller aufsuchen. Selbst wenn nachts nach null Uhr Fliegeralarm war, der mehr als 20 Minuten dauerte, fielen morgens die beiden ersten Stunden aus. Der verheerende Angriff auf Koblenz am 6. November 1944 war für die Stadtverwaltung Koblenz Anlaß, alle Schüler im Januar 1945 zu evakuieren, was nicht bedeutet, daß bis dahin noch Schulunterricht stattgefunden hätte. Tatsächlich waren die Schulen schon seit Monaten geschlossen, weil ein geordneter Schulbetrieb wegen der vielen Unterbrechungen durch Fliegeralarme nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Viele Schüler kamen auch von auswärts und mancherorts waren die Straßen und Schienenwege zeitweise unterbrochen oder zerstört, so daß die Schüler auch aus diesem Grunde nicht mehr nach Koblenz kommen konnten. Wir, die Neuendorfer, waren zuletzt täglich zu Fuß in die Hohenzollernstraße gegangen, weil auch die Straßenbahnen nicht mehr fuhren. Hin und zurück waren das für uns täglich acht Kilometer Fußmarsch.
Mein Vater bekam vieles von dem nicht mit. Er ist 1944 noch einmal dienstverpflichtet worden. Das bedeutete weg von der Familie und als Eisenbahner Versetzung nach Schlesien und Polen. Die Nachschublinien der deutschen Wehrmacht für den Rußland-Feldzug mußten aufrechterhalten bleiben. Er war - wie ich mich noch gut erinnere - in den Bereich Krakau - Lemberg gezogen (damals gehörte Lemberg noch zu Polen; nach dem Krieg mußten die Polen das Gebiet um Lemberg an die Sowjetunion abtreten - heute gehört es zu Weißrußland); ein Ort namens Rawa Russka ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. So war meine Mutter wieder mit sechs Kindern allein; ich war erst zwölf Jahre alt und nach ihrer Auffassung als ältester Sohn mitverantwortlich für die Familie. Auch meine älteste Schwester Brigitte mußte in Maßen mitarbeiten; erst im November 1944 wurde sie elf Jahre alt.
Für mich war das keineswegs eine angenehme Zeit. Da galt es, wöchentlich die Straße und den Hof zu fegen, die Kaninchenställe zu reinigen, samstags sämtliche Schuhe aller Familienmitglieder zu putzen (und das waren mindestens immer 15 Paare), täglich für die Kaninchen Futter herbeizuschaffen und auch im Garten zu helfen, wo dies möglich war - und da war viel möglich. Am schlimmsten war die Futtersuche für mehr als 20 Kaninchen. Das ging nur mit Handwagen. Löwenzahn, Daudistel, Klee, Gemüsereste von Wirsing, Kohl und Möhren waren begehrte Güter, hinter denen ich fast täglich her war. Aber dafür mußte ich - wenn ich nicht genügend am Straßenrand fand - auf fremde Grundstücke. Und das war übel. In dieser Zeit lernte ich die Bauern wirklich kennen. Namentlich und von Angesicht zu Angesicht kannte ich sie alle, und alle kannten auch meine Familie, und alle wußten, wie es wirtschaftlich um uns bestellt war. Das alles hielt sie aber nicht davon ab, mich von ihren Grundstücken zu verjagen, wenn sie mich erwischten, obwohl ich nur Abfälle einsammelte, die sie ohnehin eingepflügt hätten. Bei diesen Bauern hätten die Familien verhungern können.
Normal einkaufen konnte man schon viele Jahre nicht mehr. Selbst wer Geld genug hatte, konnte nicht alles kaufen. Es gab Lebensmittelkarten und Bezugscheine. Nur mit Hilfe dieser Papiere war es möglich, etwas zu erstehen. Unsere Familie hatte zeitweise nicht genug Geld, um auf alle Karten etwas einkaufen zu können, und das, obwohl die Preise damals verhältnismäßig niedrig waren. Ein drei Pfund schweres Brot kostete 56 Pfennige, ein Liter Milch nur 28 Pfennige. Ein Ei war für drei Pfennige zu haben, ebenso eine Schachtel Streichhölzer. Dank unserer Kaninchen hat meine Mutter weitgehend auf den Einkauf von Fleisch verzichten können und die Karten einer anderen Familie überlassen, die uns dafür Bekleidung für die Kinder ohne Kosten für uns beschaffte. Trotz allem gab es jedoch nicht jeden Tag Fleisch; höchstens zweimal in der Woche. Und auch sonst erinnere ich mich, daß wir weder Wurst noch Käse auf dem Brot hatten, manchmal einen Schmelzkäse. An den Namen Velveta kann ich mich noch erinnern. Es gab immer „doppelte Brote" - auf der einen Scheibe war Margarine geschmiert, auf der anderen Marmelade, meistens „Grafschafter Goldsaft" (früher hieß das Rübenkraut). Die Portionen auf die einzelnen Abschnitte der Lebensmittelkarten wurden wöchentlich festgelegt. Trotzdem war die Versorgung der Bevölkerung bis zuletzt einigermaßen sichergestellt. Nach dem Ende des verlorenen Krieges sollte es noch viel schlimmer werden.
Das Kriegsjahr 1944 war für uns das schlimmste. Die ständigen Fliegerangriffe und die Bombardierungen machten die Bevölkerung mürbe. Das war sicher von den Kriegsgegnern, den Amerikanern und Engländern, so gewollt; die Franzosen hatten zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen, sie waren 1940 schon besiegt worden. Bei Fliegeralarm beteten wir immer (die meisten Familien taten das auch): Rosenkranz und sonstige Gebete wie „Aus der Tiefe rufe ich Herr zu Dir". Ob das Gebet etwas geholfen hat? Sicher hat es nicht geschadet. Die schlimmste Nacht war die des 6. November. Ich war bei Alarm mit meiner Mutter und den beiden Brüdern Bernhard und Ludwig - letzterer war noch nicht zweieinhalb Jahre alt - in unseren eigenen Keller hinabgestiegen. Dieser Keller war nicht als Luftschutzkeller ausgebaut. Es war zwar ein Gewölbekeller aus Bruchsteinen; er hatte aber keine dicht verschließbare Tür und nicht ein ebensolches Fenster. Meine drei Schwestern waren gegenüber bei Urmetzers (unsere Nachbarn) im für den Luftschutz ausgebauten Keller. Der Angriff begann mit dem unheimlichen Heulen der herabfallenden Bomben. Und dann bebte die Erde, das Haus wurde durchgerüttelt, die Kellertür flog auf und ein starker Luftzug rauschte durch den Keller. Es krachte rund um uns her und jeden Augenblick dachte ich, meine letzte Minute ist gekommen, wenn das Haus über uns zusammenstürzt und uns im Keller verschüttet. Zwischendurch versuchte ich, meine Mutter zu überreden, gegenüber in Urmetzers Keller zu fliehen, der mir sicherer schien. Aber meine Mutter lehnte ab. Und so harrten wir der Dinge. Zwanzig Minuten dauerte der Angriff - sie erschienen uns wie eine Ewigkeit. Und dann ließ das Zischen und Tosen allmählich nach, das Motorengeräusch der Flugzeuge entfernte sich - es trat Stille ein, Erleichterung: Wir lebten noch. Endlich teilten die Sirenen Entwarnung mit. Wir konnten den Keller wieder verlassen.
Obwohl unser Haus noch stand, bot sich ein Bild der Verwüstung. Von dem ständigen Sog oder Druck herabfallender Bomben waren viele Hausdächer abgedeckt, alle Fensterläden waren aufgeflogen und teilweise zerstört. Keine Fensterscheibe war mehr im Rahmen, überall lagen Glassplitter und sonstige Dinge, die einfach um- oder herabgefallen waren. Die größte Ernüchterung erlebte ich aber erst auf der Gasse direkt vor unserem Haus, als meine Mutter und ich zu Urmetzers gingen, um nach den Mädchen zu schauen. Die ganze Gasse lag voll mit Dachschieferplatten. Sie sind von dem gegenüberliegenden Haus, das keine Regenrinne hatte, heruntergerutscht. Ich stellte mir vor, was wohl mit mir geschehen wäre, wäre ich - wie ich gewollt hatte - aus unserem Keller geflüchtet. Möglicherweise hätten sie mir den Schädel gespalten. Ich hatte wohl einen guten Schutzengel; meine Mutter war der Schutzengel. Sie wird es auch öfter gewesen sein; und nicht nur für mich.
Koblenz war ein Trümmerhaufen. Es brannte überall - noch Tage lang. Eine stolze Stadt war binnen einer halben Stunde in Schutt und Asche gelegt worden. Luftminen, schwerste Bomben und Brandbomben waren auf die Stadt niedergegangen; es war wie in einem Feuermeer. 400 „fliegende Festungen" hatten ihre Last auf Koblenz abgeworfen. Später, als ich Schillers Lied von der Glocke las, hatte ich das Geschehen wieder vor Augen: „Das ist nicht des Tages Glut! Welch Getümmel, Straßen auf! Dampf wallt auf! Flackernd steigt die Feuersäule, durch der Straßen lange Zeile wächst es fort mit Windeseile, kochend wie aus Ofens Rachen glüh’n die Lüfte, Balken krachen, Pfosten stürzen, Fenster klirren, Kinder jammern, Mütter irren, Tiere wimmern unter Trümmern, alles rennet, rettet, flüchtet, taghell ist die Nacht gelichtet".
Nach diesem Angriff war die persönliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet, zumal - was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wußten - noch weitere Angriffe folgen sollten. Meine Mutter überlegte, ob es eine Möglichkeit gibt, wenigstens die beiden Mädchen Brigitte und Trudel in Sicherheit zu bringen. Mich brauchte sie als Beistand, und die anderen Kinder Bernhard, Therese und Ludwig waren noch zu jung, um sie "wegzugeben". Meine Mutter hatte eine Idee, und die eröffnete Sie mir noch im November 1944.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Vergebliche Evakuierung nach Reifferscheid
(6) - Ob es mit den Verwandten in Reifferscheid abgestimmt war, weiß ich nicht. Wenn überhaupt, hätte dies brieflich geschehen müssen, denn ein Telefon hatten sie nicht. Jedenfalls bat mich meine Mutter darum, meine Schwestern Brigitte und Trudel nach Reifferscheid zu bringen und anschließend selbst wieder zurückzukommen. Ich kannte den Weg; denn ich war des öfteren mit meinem Vater mit der Eisenbahn dorthin gefahren und auch dort schon mal in Ferien gewesen. Es gefiel mir. Den ganzen Bauernbetrieb fand ich interessant und arbeitete auch gern mit. Da gab es Kühe zu hüten, Heu vom Heustall hinunterzuwerfen, das Fuhrwerk anzuspannen, zu pflügen, Heu zu wenden und aufzuladen, Getreidegarben aufzustellen und beim Dreschen zu helfen. Zwei Ochsen zogen das Fuhrwerk und die landwirtschaftlichen Geräte. Es gab auch Kühe, Schweine, Hühner und Gänse. Mit Onkel Josef war ich fast den ganzen Tag zusammen. Er war ein freundlicher Mann und stets guter Laune. Von ihm habe ich sehr viel gelernt.
Nach Reifferscheid also. Meine Mutter erklärte mir, es sei ihr zu gefährlich mit den Kindern; sie könne es nicht mehr verantworten, alle Kinder bei der drohenden Bombengefahr immer um sich zu haben. Mit nur wenig Gepäck machten wir uns eines Tages auf den Weg; denn um nach Reifferscheid zu gelangen, benötigte man höchstens drei Stunden. In Lützel stiegen wir in den Zug ein und fuhren rheinabwärts über Andernach und Bad Niederbreisig nach Remagen. Dort mußten wir auf die Ahrtal-Strecke umsteigen. Bis nach Remagen verlief alles ganz normal. Am Bahnhof aber erklärten uns die Beamten, daß heute kein Zug die Ahrstrecke - wir mußten bis nach Adenau - fahren könne, weil diese von feindlichen Flugzeugen in der letzten Nacht bombardiert worden und sie deshalb zur Zeit unpassierbar sei. Vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, per Anhalter mit einem Lastwagen zu fahren. Ich machte mich also mit meinen beiden Schwestern zu Fuß auf in Richtung Sinzig. Kurz vor Sinzig zweigt die Straße ins Ahrtal ab. Das sei ein günstiger Punkt, um einen Lastwagen zu erwischen, erfuhren wir. Aber bis dahin kamen wir nicht. Im Gleisdreieck Rhein - Ahr waren wir gezwungen, Deckung aufzusuchen, weil die Eisenbahnstrecke in diesem Bereich von feindlichen Jagdfliegern unter Beschuß genommen wurde. Bei allem hatten wir noch Glück, weil sich genau in diesem Gebiet an der Bundesstraße 9 ein Gasthaus befand, in das wir flüchteten (dieses Gasthaus gibt es heute nicht mehr; es fiel dem Verteilerkreisel nördlich von Sinzig, da wo auch heute noch die Ahrstrecke abzweigt, zum Opfer). Die Wirtin war zuhause und ging mit uns in den nahen Splittergraben, um Schutz zu suchen. Wir hörten die Sturzflüge der Maschinen und das Rattern der Bordkanonen. Welches Ziel sie hatten, konnten wir zunächst nicht ausmachen - aber im Laufe des Tages sollten wir es noch schmerzlich erfahren. Als der Spuk vorbei war, gab uns die Wirtin noch etwas zu essen, sie war sehr freundlich zu uns und hatte großes Mitgefühl. Ich weiß heute noch genau, was sie uns anbot: Kartoffeln und Spinat untereinander. Eigentlich hätten wir zu dieser Uhrzeit schon in Reifferscheid sein können. Unsere anschließenden Bemühungen, noch einen Lastwagen zu finden, haben wir im Laufe des Nachmittags erfolglos abbrechen müssen. Ich entschied, mit dem Zug wieder zurück nach Koblenz zu fahren. Also machten wir uns wieder auf den Weg - zu Fuß zurück nach Remagen zum Bahnhof. Das waren etwa drei Kilometer.
Hier erfuhren wir zu unserem Schrecken, daß linksrheinisch Züge in Richtung Koblenz nicht mehr verkehren könnten. Bei dem Angriff am Mittag, bei dem wir im Splittergaben hockten, waren die Gleise südlich von Remagen so zerstört worden, daß Züge nicht mehr fuhren. Um überhaupt noch nach Koblenz zu gelangen, blieb nur die rechtsrheinische Verbindung offen. Mit den beiden Mädchen - es war inzwischen später Nachmittag geworden - mußte ich über die Rheinbrücke, die sogenannte Erpeler Brücke, nach Erpel. Diese Brücke hat als Brücke von Remagen in den letzten Kriegstagen eine große Berühmtheit erlangt; es wurde auch ein Film darüber gedreht. Wir hatten Glück im Unglück; denn wir erwischten einen Zug in Richtung Koblenz-Ehrenbreitstein. Unterwegs begann es dunkel zu werden, es war schon Ende November und die Tage waren nicht mehr so lang. Während der Fahrt gab es wieder Fliegeralarm. In der Nähe von Fahr-Irlich, nördlich von Neuwied, mußte der Zug, der unter Beschuß genommen war, anhalten. Gott sei Dank zogen die Flugzeuge bald wieder ab. Es war nichts Schlimmes geschehen, und der Zug konnte weiterfahren. Ohne nochmalige Unterbrechung stieg ich mit den Mädchen in Ehrenbreitstein aus.
Müde waren wir alle, und Hunger hatten wir auch; denn außer dem Frühstück am Morgen und der kleinen Mahlzeit auf dem Weg nach Sinzig hatten wir den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken - und spät war es auch. Es wird gegen 22,30 Uhr gewesen sein, als wir den Fußmarsch nach Neuendorf antraten. Wir mußten Rhein und Mosel überqueren und es war ein weiter Weg, obwohl man von Ehrenbreitstein - wäre es hell gewesen - Neuendorf gut sehen konnte. Als weiteres Mißgeschick erwies sich, daß die Schiffbrücke über Nacht ausgefahren war, und wir deshalb den Weg über die Pfaffendorfer Brücke - einen weiteren erheblichen Umweg - nehmen mußten. Total erschöpft kamen wir nach 24,00 Uhr zu Hause an. Auf unser Klopfen öffnete unsere Mutter die Tür und konnte nicht verstehen, wieso wir es waren. Hatte sie uns doch längst wohlbehütet in Reifferscheid geglaubt. Sie weinte bitterlich. Nie mehr habe ich meine Mutter so aufgelöst gesehen wie in dieser Nacht.
Ich war noch nicht 13 Jahre alt, als dies geschah. Sehr früh hatte ich Verantwortung übernehmen müssen. Eine solch große Verantwortung wollte meine Mutter mir wohl nicht noch einmal übertragen. Nach ihrer weiteren Überlegung zogen wir zwei Wochen später - am 6. Dezember (es war Nikolaus-Tag) - doch noch nach Reifferscheid; diesmal mit der ganzen Familie - nur Vater fehlte, der war noch in Polen.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Die letzten Kriegsmonate bei unseren Verwandten
in Reifferscheid
(7) - Was mit unserem Vieh geschah, daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Schließlich hatten wir eine Katze, eine Menge Kaninchen und Hühner, die wir ja nicht mitnehmen konnten. Wahrscheinlich hatten sich Urmetzers, unsere Nachbarn, darum gekümmert. Doch der Umzug nach Reifferscheid bedurfte der Vorbereitung. Immerhin mußten wir genügend Kleider für den Winter mitnehmen, und auch Bettzeug; denn davon hatten die Verwandten sicher nicht genug. Auch mußten wir uns polizeilich abmelden. Das war mit der Erklärung, wir zögen zu Verwandten, notwendig, um einer Evakuierung nach Thüringen zuvorzukommen. Die Neuendorfer Bevölkerung wurde wegen der großen Gefährdung durch Fliegerangriffe nach Thüringen evakuiert. Mutter hatte sicher recht, daß es uns bei Verwandten besser ergehen könne als bei fremden Menschen in einer fremden Gegend. Und außerdem wollte sie nicht den Russen entgegengehen.
Alles, was wir mitnehmen mußten, wurde in einen großen, aus Weiden geflochtenen Schließkorb und in weitere Koffer und Kisten verpackt und beim Bahnhof Lützel als Gepäck zum Transport nach Adenau aufgegeben, weil wir ja nicht alles persönlich mitnehmen konnten. Leider ist dieses Gepäck niemals in Adenau angekommen. Alle Nachforschungen blieben ergebnislos. Die letzten amtlichen Vermutungen waren, daß wegen der ständigen Bombardierungen der Ahrstrecke die Gepäckstücke in Remagen liegen geblieben sind, wo sie hätten umgeladen werden müssen. Nach Kriegsschluß sind sie dann wohl geplündert worden. Jedenfalls haben wir nie mehr etwas davon gesehen. Vieles davon war noch völlig neu, also ungebraucht. Mutter hatte bei ihrer Sparsamkeit immer zusammengenähte, alte Sachen benutzt. Das hätte sie besser nicht getan, sie hätte dann noch etwas von den neuen Sachen gehabt. Besser wäre es auch gewesen, die Sachen überhaupt nicht zu verschicken! Denn in Neuendorf wäre nichts passiert. Nach dem Krieg hätten wir weiter darüber verfügen können. Doch das konnten wir im Dezember nicht wissen.
Ob wir in Reifferscheid herzlich aufgenommen worden sind? Wir wurden aber aufgenommen, und das war auch für unsere Verwandten nicht einfach und leicht. Immerhin waren wir nicht die einzigen, die aufgenommen wurden. Auch Tante Lisbeth, die Frau von Onkel Peter,
(Reifferscheid im Jahre 1937,
Onkel Josef vor seinem Haus, das auch 1950 noch so aussah, mit Tante Lisbeth.Das Haus, in dem meine Mutter ihre Kindheit verbrachte und in dem wir von Dez. 1944 - April 1945 wohnten)
dem Bruder meiner Mutter (beide waren ja zusammen in Reifferscheid nach dem Tod ihrer Mutter herangewachsen), war mit den beiden Mädchen Loni und Marga von Koblenz dorthin gekommen. Onkel Peter war in Rußland, Sohn Alfons ebenfalls bei Militär, und der älteste Sohn Hans war seit 1943 in Frankreich vermißt. So haben unsere Verwandten also zwei erwachsene Personen und acht Kinder zusätzlich in ihrem Haushalt gehabt, der selbst aus vier Personen bestand: Onkel Josef (ich erwähnte ihn bereits) und Tante Apollonia, die Schwester meiner Großmutter, Erna, die Tochter der beiden, und Onkel Peter, der unverheiratete Bruder von Tante Apollonia.
In Reifferscheid gab es 1944 kein fließendes Wasser. Alles Wasser mußte aus Brunnen geschöpft werden, die im ganzen Ort verteilt an verschiedenen Stellen zu finden waren. Es waren mit Bruchsteinen gebaute tiefe, runde und überdachte Brunnen, in denen sich das Grundwasser, zum Teil aber auch das Oberflächenwasser sammelte. Ob es immer hygienisch rein war, ist zu bezweifeln; denn eine Kanalisation gab es auch nicht. Alle Brühe, egal wie sie aussah - zum Teil auch Jauche, lief über die Straßen ab. Das Brunnenwasser wurde mit Hilfe einer Spindel, über die eine Kette lief, aus dem Brunnen noch oben gezogen und in Eimern nach Hause getragen.
Elektrisches Licht gab es zwar, aber oft war es infolge von Kriegseinwirkungen ausgefallen oder das Elektrizitätswerk stellte täglich stundenweise den Strom ab, weil nicht so viel produziert werden konnte. Abends saßen die Menschen dann im Dunkeln, wenn man keine Kerze oder Öllampe hatte. Und wer hatte schon so etwas? Das gab es ja auch nicht. So behalf man sich mit Karbid. Die Bauern hatten immer noch eine Möglichkeit, an Karbid heranzukommen. Die Karbid-Lampen stellten sie mit Hilfe von zwei leeren Konservendosen unterschiedlicher Größe selbst her. Die kleinere Dose diente zur Aufnahme des Rohkarbids und wurde mit einem angepaßten, selbst hergestellten Holzpfropfen fest verschlossen. In die ehemalige Unterseite dieser Dose wurde ein winziges Loch geschlagen und diese Dose sodann mit der Seite, die mit dem Pfropfen verschlossen war, in die größere Dose gestellt, die mit Wasser ganz oder teilweise gefüllt war. Durch den Holzpfropfen zog die Feuchtigkeit in die obere Dose ein, das Karbid löste sich auf, das entstehende Gas entwich auf der Dosen-Oberseite und konnte angezündet werden. Die Konstruktion ergab ein klares, helles und weißes Licht. Je nach Größe des Lochs war die Flamme größer oder kleiner.
Es war, das kann sich jeder denken, sehr eng in der Familie. 14 Personen an einem Tisch. Das ging fast immer nur in zwei Etappen. Und Schlafzimmer? So viele Schlafzimmer hatte das Haus nicht. Ich erinnere mich, daß in einem engen, langen Raum vier Doppelbetten nebeneinander aufgestellt worden sind, und zwar quer im Zimmer. Das Zimmer war aber so schmal, daß man am Kopf- oder Fußende der Betten nicht vorbei kam. Wer also das vierte Bett erreichen wollte, konnte dies nur über die drei davor stehenden. In diesem Zimmer schlief meine Mutter mit ihren sechs Kindern. Die Familie von Tante Lisbeth bekam ein anderes, ähnliches Zimmer. Reibereien blieben bei diesen Verhältnissen nicht aus. Besonders Erna wurde es manchmal zu viel.
(Erna, - * 1923 + 07.10.1987 - die Tochter von Onkel Josef und Tante Apollonia)
Es war für sie dieselbe Situation wie 30 Jahre früher, als die beiden Kinder - meine Mutter und ihr Bruder - in die Familie der Großmutter aufgenommen worden waren. Damals hatte Ernas Mutter die Probleme mit den Kindern. Aber zu ernsthaften Auseinandersetzungen ist es nicht gekommen. Tante Lisbeth und meine Mutter, aber auch die beiden ältesten Mädchen, Loni und Brigitte und ich selbst, arbeiteten mit. Meistens fuhr ich mit Onkel Josef aufs Feld oder in den Wald. Im Winter wurde Holz gemacht - Bäume gefällt. Hier lernte ich, wie das gemacht wird. Holzhauen, Straße und Hof sauber halten, Stall misten, Heu vom Heustall herunter werfen, waren Arbeiten, die ich verrichten konnte. Auch dreschen habe ich gelernt - aber mit dem Flegel. Es war gar nicht so einfach, wie es aussah. Mit Onkel Josef und Onkel Peter mußte das im Takt gehen, damit man sich nicht selbst und gegenseitig die Flegel um die Ohren schlug.
Wegen der Ernährungs-Bewirtschaftung in den Kriegsjahren ließen sich die Leute so allerlei einfallen. Ich erinnere mich, daß ich mit Onkel Josef nachts zu einer Familie ging, die über eine Mühle verfügte, die von einem Elektromotor angetrieben wurde und auf der man Öl pressen konnte. Davon durfte natürlich niemand etwas wissen; solche Vergehen wurden mit Gefängnis bestraft. Den Raps zogen unsere Verwandten selbst, und daraus wurde Rüböl gepreßt. Den Ölkuchen, das was von dem Raps übrig blieb, wurde den Schweinen verfüttert.
Eines Tages tauchte ein Kontrolleur auf unserem Hof auf, um die Hühner zu zählen. Zur Aufrechterhaltung der Ernährung mußten die Bauern ja nicht nur Fleisch und Getreide, sondern auch Eier abgeben. Bei den jährlichen Erhebungen mußten sie deshalb im Fragebogen auch die Anzahl der Hühner angeben. Und diese Zahl wurde kontrolliert. Hierbei konnte ich die Schlitzohrigkeit der Bauern bewundern. Die Hühner liefen frei umher, und um sie zählen zu können, mußten sie versammelt werden. Das geschah, indem man ihnen Getreidekörner in den Hof warf - dann kamen sie von allen Seiten. Und dann wurde gezählt; der Kontrolleur zählte mit. Bei einer bestimmten Zahl angekommen, sagte meine Tante, das seien ihre Hühner, die übrigen seien von ihren Nachbarn, obwohl das überhaupt nicht stimmte. Und die Nachbarn machten es genau so.
Es war selbstverständlich, daß unsere Verwandten nicht den gesamten Unterhalt für uns übernehmen konnten. Mit Hilfe unserer Lebensmittelkarten versorgten wir uns weitgehend selbst. In Reifferscheid gab es damals aber nur einen kleinen Krämerladen, ein Kolonialwarengeschäft - wie es hieß, in dem gleichzeitig auch die Postsachen erledigt wurden, weshalb man, wollte man größere Mengen kaufen, meistens nach Adenau oder Antweiler gehen mußte. Ja, man mußte gehen; eine öffentliche Verkehrsverbindung gab es nicht, und ein Auto oder einen Traktor hatte auch niemand. Wenn überhaupt, hätte man höchstens mit dem Ochsenfuhrwerk fahren können. Die kürzesten Wege nach Adenau oder Antweiler führten durch Feld und Wald; 50 Minuten nach Adenau, zehn Minuten länger nach Antweiler, wohlgemerkt, eine Strecke. Brot kauften wir immer in einer dieser beiden Gemeinden. Es waren meistens zehn bis zwölf Brote zu je drei Pfund, die wir erwarben. Die reichten für eine Woche. Um sie nicht schleppen zu müssen, transportierten wir sie in einem Kinderwagen, über den wir verfügten, weil die jüngsten Kinder - Ludwig und Marga - manchmal auch noch damit gefahren wurden. Holten wir die Brote in Adenau, mußte der Rückweg über Honerath führen, weil der andere Weg zu steil und mit einem Kinderwagen nicht befahrbar war. Die Strecke über Honerath betrug fast acht Kilometer und war in knapp zwei Stunden zu bewältigen. Wegen unseres Wohnortes Reifferscheid mußten wir das Brot eigentlich in Adenau kaufen. Aber wegen der Bewirtschaftung gab es nicht immer welches. Wenn wir dann nach Antweiler gingen, wurden wir manchmal nach unserem Wohnort gefragt. Als Reifferscheider hätten wir kein Brot bekommen. Deshalb logen wir und sagten, wir wohnten in Dorsel; weil diese Gemeinde zum Amt Antweiler gehörte.
In den ersten Tagen, als wir bei unseren Verwandten wohnten, gab es noch Einquartierung. So nannte man es, wenn die Militärkommandantur den Soldaten befohlen hatte, in bestimmten Häusern zu übernachten. Vorher waren Quartiermacher dort, die entschieden hatten, wie viele Soldaten jede Familie aufnehmen konnte. Die Soldaten befanden sich im Aufmarsch für die sogenannte Ardennen-Offensive, der letzte, verzweifelte Versuch Hitlers, das Kriegsglück doch noch zu seinen Gunsten zu wenden. Wie sich herausstellte, war dieser Versuch überflüssig und erfolglos. Diese verlorene Offensive war der endgültige Anfang vom Ende.
Weihnachten 1944 gab es in Reifferscheid viel Schnee. Er lag etwa 40 bis 50 Zentimeter hoch und an manchen Stellen gab es mächtige Verwehungen.
Einige Tage später, als wir übten, Ski zu laufen - das waren vom Schreiner hergestellte Bretter mit Lederbindung - sah ich einen Mann durch den Schnee stapfen. Er kam aus Richtung Winnerath und zog zwei Holzkoffer hinter sich her durch den Schnee. Nahe genug herangekommen erkannte ich meinen Vater. Im Osten war seine Dienststelle wegen der herannahenden Russen aufgelöst und die Mitarbeiter in Urlaub geschickt worden. Infolge der zerstörten Ahrtal-Bahnlinie kam mein Vater zu Fuß von Bonn über die Grafschaft und Schuld an der Ahr nach Reifferscheid. Das war wegen des vielen Schnees ein äußerst anstrengender Fußmarsch. Aber wir waren sehr froh, ihn einmal wieder zu sehen. Er konnte einige Tage bleiben und mußte dann wieder zurück. Er hatte Auftrag, sich bei seinem Heimatbahnhof Ehrenbreitstein zu melden.
Die Westfront rückte immer näher zu uns heran. Einerseits versuchte die deutsche Wehrmacht, mit den damals von Wernher von Braun konstruierten Fernlenkwaffen, V 1 oder V 2, den alliierten Gegner von Deutschland aus zu attackieren. Wir hörten nachts, später auch tagsüber, diese Waffen über uns hinweg fliegen (mitunter konnte man sie auch sehen); andererseits hielten die alliierten Flieger deutsche Stellungen mit ihren Lightning- oder Thunderbold-Jägern unter Beschuß. Von der Höhe von Reifferscheid aus konnten wir sehr gut sehen, wenn die feindlichen

(Reifferscheid im Winter)
Flieger im Tiefflug anflogen und sich - aus Bordkanonen schießend - in die umliegenden Täler auf die Stellungen in Adenau, Schuld, Fuchshofen oder Antweiler stürzten. Ich erinnere mich noch an einen Sonntagnachmittag, als die deutsche Vierlingsflak in Schuld innerhalb von zehn Minuten vier britische Doppelrumpf-Lightning-Jäger abschoß. Einmal fielen auch Bomben, allerdings ohne großen Schaden anzurichten; sie gingen im freien Feld zwischen Reifferscheid und Rodder nieder. Tante Apollonia saß gerade auf der Toilette (besser: Plumpsklo) und meinte nachher, die Amerikaner hätten wieder mit ihren Bordwaffen geschossen.
Vor den alliierten Flugzeugen war man nirgendwo sicher, auch nicht vor der heranrückenden Front. Deshalb bauten die Männer von Reifferscheid auch einen großen unterirdischen Schutzraum. Dieser befand sich in Richtung Honerath im Bereich der Alte Burg. Splittergräben wurden ebenfalls errichtet. Der nächste für uns erreichbare war nur wenig außerhalb der Gemeinde in Richtung Winnerath, von unserem Haus nur etwa 100 Meter entfernt. Auch Onkel Josef machte sich Gedanken wegen der heranrückenden Front und faßte den Beschluß, eine mögliche Ersatzunterkunft - ein Ausweichquartier - zu errichten. Mit meiner Mithilfe hat er auch damit begonnen, etwa 1,5 bis 2 Kilometer entfernt, in einem ihm gehörenden Waldstück, Kohlrosenbusch genannt, von Reifferscheid in Richtung Laufenbach/Ahr gelegen. Aber dann haben wir die Arbeiten eingestellt, weil es unmöglich schien, eine so große Familie im Winter Tag und Nacht in einer selbst gezimmerten Hütte unterzubringen.
Noch im Januar und Februar wurden junge Männer zur Wehrmacht eingezogen. Viele, die der Einberufung gefolgt sind, sind - oft nicht 18 Jahre alt - noch in den letzten Kriegstagen gefallen. Wofür? Einer von Walds, der Familie, die uns gegenüber wohnte - Alois hieß er und hatte noch acht Geschwister und sein Vater war schon früh gestorben, folgte der Einberufung nicht. Das alles erfuhren wir natürlich erst nach dem Ende des Krieges. Damals hieß es, er fahre nach Koblenz zur Einberufung. Zwei Tage später war er aber wieder zu Hause mit der Begründung, wegen Bombardierung der Eisenbahnstrecke sei er nicht nach Koblenz gekommen. Einige Wochen später erhielt er einen weiteren Einberufungsbescheid. Und wieder machte er sich auf den Weg. Diesmal kam er aber nicht zurück. Erst als die Amerikaner Reifferscheid „erobert" hatten, sahen wir Alois wieder. Er war nicht zur Einberufung gefahren, sondern hatte sich versteckt, wo, das war nicht zu erfahren, und hat gewartet, bis die Gefahr vorüber war.
* * *
Kriegsende! - Zurück - nach Hause!
(8) - Irgenwann war es dann soweit. Man erfuhr von Dorf zu Dorf, wie weit die Amerikaner schon herangekommen und welche Gemeinden eingenommen worden waren. Als sich die deutschen Truppen eines Abends aus Reifferscheid zurückzogen, waren alle sehr erleichtert. Niemand war einem Kampf um die Einnahme oder Verteidigung dieses Ortes interessiert. Mit einer Verteidigung war aber immer zu rechnen, weil damals alle Orte mit sogenannten Panzersperren versehen waren, die vom Volkssturm verteidigt werden sollten. Volkssturm war eine Gemeinschaft der nicht mehr wehrpflichtigen und wehrtüchtigen Männer, die im Verteidigungsfall aber noch militärische Aufgaben erfüllen sollten. Dieser Volkssturm dachte aber in Reifferscheid nicht an eine Verteidigung. Die Panzersperren blieben geöffnet, alle Waffen, hauptsächlich Gewehre und Maschinenpistolen wurden - wie wir später erfuhren - noch in die Brunnen geworfen, damit die Amerikaner sie nicht finden sollten, und im Laufe der Nacht wurden riesige weiße Bettücher als Zeichen der Unterwerfung am Kirchturm befestigt, der schon von weit her sichtbar war. Auch die einzelnen Häuser hielten weiße Tücher für die Übergabe bereit.
Und dann kamen sie, die Amerikaner. Es war etwa sieben Uhr morgens. Mit Panzern und Lastwagen rollten sie aus Richtung Honerath an. Vorsichtig, hinter jeder Straßenbiegung einen Hinterhalt vermutend. Aber nichts geschah. Die Menschen in den Häusern hingen die weißen Bettücher aus den Fenstern und empfingen den "Feind". Die Amerikaner, viele davon mit schwarzer Hautfarbe; solche Männer hatte man in Reifferscheid leibhaftig wahrscheinlich noch nie gesehen, durchstöberten Haus für Haus. Es fiel nicht ein einziger Schuß. Statt dessen versorgten die "Schwarzen" die einheimischen Kinder mit Schokolade und sonstigen Süßigkeiten. Wer von den Kindern kannte zu diesem Zeitpunkt Schokolade? Fest steht: Die Amerikaner wurden nicht feindselig aufgenommen. Warum auch? Wir hatten sowieso keine Wahl.
Direkt hinter unserem Haus - es war das letzte in der Straße - richteten die Amerikaner einen Versorgungspunkt ein. Auch hier machten vor allem Schwarze die Arbeit. Mein Bruder Bernhard - gerade sieben Jahre alt - freundete sich mit diesen Soldaten besonders an. Fast den ganzen Tag brachte er bei ihnen zu, und bei dieser Gelegenheit fiel ganz besonders viel für ihn ab.
Von irgendwelchen Übergriffen der Soldaten auf die deutsche Bevölkerung habe ich nie etwas gehört. Es gab zwar keine himmlische Ordnung, das ist bei einer Besatzung sicher nicht möglich, aber es herrschte Frieden - zumindest in Reifferscheid. Man konnte wieder ruhig schlafen; denn unmittelbares Kriegsgeschehen gab es nicht mehr, auch keine Bombardierungen mehr und auch keine Jagdflieger-Überfälle mit Bordwaffen-Beschuß.
Eines Tages erzählten sich die Männer des Dorfes, die deutschen Truppen hätten sich so schnell zurückziehen müssen, daß sie nicht mehr alles hätten mitnehmen können. Mit "alles" waren Geräte und vor allem Pferde gemeint. Es verbreitete sich also die Kunde, bei Hohenleimbach, das ist ein kleiner Ort an der Hohen Acht in Richtung Kempenich, stünden 200 verlassene Armeepferde. Also beschlossen die Männer, am nächsten Tag dorthin aufzubrechen, um sich mit diesen Pferden zu bedienen. Die Männer dachten, es sei einmal etwas anderes; nicht immer nur mit Ochsen fahren und arbeiten müssen. Onkel Josef und ich gingen auch mit. Es war ein weiter Weg von etwa 15 Kilometern, der uns zunächst hinunter nach Leimbach und dann immer aufwärts über Kalenborn in Richtung Hohe Acht und Kempenich führte. Onkel Josef muß inzwischen die Lust an dem ganzen verloren haben; denn irgendwann war er nicht mehr zu sehen. Was hat dort alles am Wegrand gelegen an zurückgelassenem Material der deutschen Soldaten. Das hat mich wohl so beeindruckt, daß ich immer mehr den Anschluß an die Gruppe verlor und plötzlich den Weg nicht mehr wußte. Zufällig vorbeikommende Personen fragte ich nach dem Weg nach Leimbach. Sie zeigten ihn mir. Aber bald merkte ich, daß ich wohl in die falsche Richtung ging und konnte mir das nicht erklären. Irgenwann später sah ich die ersten Männer aus Reifferscheid zurückkommen und begriff die Aussage der Leute, die mir den Weg gezeigt hatten. Es lag eine Verwechslung vor. Ich meinte den Ort Leimbach, sie aber den Ort Hohenleimbach; das ist der Ort, bei dem die Pferde standen. Die Männer aus Reifferscheid saßen auf den Pferden und ritten nach Leimbach zurück. Sie sagten mir noch, wo ich die Pferde finden könnte. Als ich sie endlich sah, stellte ich fest, daß es wirklich eine große Herde war, ob 200, wußte ich natürlich nicht. Ich war der letzte, der ein passendes Pferd fand; nicht allzu schwer war es und von fast schwarzer Farbe. Ich band ihm einen mitgebrachten Strick als provisorisches Zügel- und Zaumzeug um, legte eine Decke über - einen Sattel gab es nicht - und dachte, "hoffentlich wirft es mich nicht ab". Ich hatte bis dahin noch nie auf einem Pferd gesessen. Aber es warf mich nicht ab. Und so ritt ich - es ging besser als erwartet - zurück in Richtung Reifferscheid. Unterwegs fand ich noch einige Decken, die ich dem Pferd ebenfalls auflegte. Am Schluß hatte ich sechs Decken unter mir, und ich dachte, die können wir zu Hause gut gebrauchen. Dabei gab es nur ein Problem: Die Decken rutschten immer und immer wieder, weil sie nicht wie ein Sattel festgezurrt waren. Und so mußte ich mehrmals absteigen und die Decken neu richten. Am Abend kam ich als letzter - aber ohne Sturz - in Reifferscheid an. Jetzt hatten wir ein Pferd. Onkel Josef war schon lange zu Hause - ohne Pferd. Die Bauern spannten die Pferde auch an und arbeiteten mit ihnen. Die Ochsen hatten Pause. Aber dafür bekamen sie auch weniger zu fressen, und sie magerten immer mehr ab.
Eine weitere Begebenheit mit diesen Pferden ist noch zu erwähnen. Irgendwann begann jemand, seinem Pferd die Schwanzhaare abzuschneiden, um einen Besen daraus zu fertigen. Wer hatte schon einen Original-Roßhaar-Besen? Es dauerte nicht lange, und fast alle machten es ihm nach. Die Pferde liefen mit ihren Schwanzstummeln, fast ohne Haare, umher. Es war ein bedauernswerter Anblick. In diesem Zustand wurden sie später den Amerikanern übergeben, als diese angeordnet hatten, die Pferde der ehemaligen deutschen Wehrmacht seien ihnen auszuliefern. Dadurch wurden die Ochsen reaktiviert.
Wenig später erfuhren wir, daß auch Koblenz in die Hand der Alliierten gefallen ist. Wir wußten zu diesem Zeitpunkt, daß unser Vater nicht mehr dienstverpflichtet worden war und wieder beim Bahnhof Ehrenbreitstein arbeitete. Das war für meine Mutter das Zeichen zum Aufbruch. Wir konnten wieder zurück nach Neuendorf. Unser Haus - auch das wußten wir schon - war zwar etwas beschädigt, aber es stand noch und war auch noch bewohnbar.
Am 9. April 1945 machten wir - meine Mutter und ich - uns zu Fuß auf den Heimweg nach Neuendorf. Es war der Tag, an dem ich 13 Jahre alt wurde. Wir hatten den Krieg überstanden, und die Familie war noch komplett. Aber was war alles zerstört? Viele deutsche Städte waren nicht wiederzuerkennen. Auch Koblenz war zu 80 bis 85 Prozent zerstört. Mehr als 1000 Menschen sind durch Bomben getötet worden. Ungefähr 3000 Verwundete hat es gegeben. Von fast siebeneinhalbtausend Gebäuden waren mehr als 4300 zerstört und etwa 3000 waren - zum Teil schwer - beschädigt. Nur ganz wenige Häuser waren heil geblieben. In der Altstadt stand fast kein Haus mehr. Der Schutt lag meterhoch in den Straßen. Überall roch es nach Rauch - auch nach Jahren noch; denn tief unten war die Glut noch nicht erloschen. Wie heißt es in Schillers Lied von der Glocke: "In den öden Fensterhöhlen wohnt das Grauen". Was war aus Deutschland geworden? Einem Verrückten war es zum Opfer gefallen: Adolf Hitler, dem "Größenwahn-sinnigen". Das Volk hatte sich von ihm blenden lassen. Noch einmal Schiller, der einen siebten Sinn gehabt haben muß: "Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu, der Gute räumt den Platz dem Bösen, und alle Laster walten frei. ... der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Weh denen, die dem Ewigblinden des Lichtes Himmelsfackel leih’n! Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städt' und Länder ein". Tröstlich für meine Eltern aber auch: "Er zählt die Häupter seinen Lieben, und sieh! Ihm fehlt kein teures Haupt". - Schillers Lied von der Glocke. Damals kannte ich Schiller noch nicht, und auch nicht seine Glocke.
* * *
Der Weg und die Heimkehr nach Neuendorf
(9) - Es war ein Montag, als wir uns auf den Weg machten, und es sollte ein weiter Weg werden - heim, zurück nach Neuendorf. Meine Mutter und ich hatten nur das Nötigste dabei, rechneten wir doch mit einer Dauer von zwei Tagen. Erstes Etappenziel war Hirten, ein kleiner Ort oberhalb von Virneburg, in dem wir hofften, eine Unterkunft zu finden, weil dort eine Frau zu Hause war, die aus Reifferscheid stammte und die meine Mutter kannte.
Durch die Leimbach ging es hinunter nach Adenau, von dort weiter über Breidscheid, vorbei an Alte Burg, hinein in den Innenkreis des Nürburgrings (den gab es damals auch schon) in Richtung Döttingen. Dort hatte Onkel Josef noch einen Bruder. Der Weg zog sich unendlich - vorbei an Ober-, Mittel- und Niederbaar - nach Virneburg. Noch nie in meinem Leben war ich einen so weiten Weg gegangen. Ich erinnere mich, daß mir (meiner Mutter wohl auch) gerade vor Virneburg die Füße sehr weh taten. Das war nicht verwunderlich, verfügten wir doch damals nicht über hervorragend gearbeitete Wanderschuhe, wie es heute bei solchen Touren üblich ist. Fast immer waren wir entlang der Straße gegangen und meine Mutter meinte, es sei vielleicht angenehmer, durch Wiesen zu gehen, soweit diese an der Straße lagen. Das taten wir hin und wieder auch und brachte vorübergehend Erleichterung wegen des weichen Untergrundes. In Virneburg kehrten wir noch einmal in ein privates Haus ein, in dem meine Mutter ebenfalls eine Bekannte aus Reifferscheid wußte. Hier erfrischten wir uns mit etwas kühlem Wasser, und dann ging es auf das letzte Teilstück hinauf durch den Wald - ziemlich steil - über Kreuznick nach Hirten, unserem Zielort, der ungefähr 500 Meter rechts der Hauptstraße liegt. Es werden wohl 22 Kilometer gewesen sein, die wir bis dahin zurückgelegt hatten - manchmal mit Angstgefühlen, besonders wenn wir amerikanischen Soldaten begegneten. Es war ja verboten, seinen Wohnort zu verlassen. Aber es geschah nichts; die meisten nahmen überhaupt keine Notiz von uns. Wie beabsichtigt, übernachteten wir im Haus der Bekannten, die uns auch mit einem Abendessen und am nächsten Tag mit einem Frühstück versorgte.
Wir brachen früh auf. Mutters Bekannte erklärte uns noch den Weg; trotzdem haben wir uns verlaufen, weil wir überwiegend querfeldein liefen, um den Weg abzukürzen. Über Reudelsterz, vorbei am Geisbüschhof und durch Siedlung Cond ging es in Richtung Kehrig und von dort weiter nach Polch. Wir merkten bald, daß es heute ein erheblich längerer Weg werden würde als gestern. Und so trotteten wir vor uns hin. Viele Wegkreuze gab es, und Mutter erklärte immer, sie seien wohl errichtet worden, weil in früheren Zeiten an dieser Stelle wahrscheinlich jemand tödlich verunglückt sei. Für die übrige Landschaft hatten wir überhaupt keinen Blick (ich selbst mit 13 Jahren erst recht nicht). Mehr und mehr schmerzten die Füße, und wir sehnten uns nach der Ankunft. Aber von Polch aus war es noch weit. Die Ortschaften Kerben und Minkelfeld fallen mir ein - auch der Karmelenberg. Vorbei an diesem Berg wanderten wir über Bassenheim nach Rübenach. Hier schöpften wir neuen Mut; denn von hier aus konnten wir Koblenz sehen. Spät war es geworden, und wir befürchteten, kurz vor dem Ziel noch aufgegriffen zu werden. Ab einer bestimmten Uhrzeit - ich glaube, 20 Uhr war festgesetzt - durfte niemand mehr auf der Straße sein. Das war eine Anordnung der Besatzungsmacht, der Amerikaner. Wir konnten absehen, daß wir nicht rechtzeitig in Neuendorf sein würden. Mettemich, quer durchs Pollenfeld, vorbei am ehemaligen Volkspark, der total zerstört war, ging es über Bahnhäuser nach Hause. Wir hatten es geschafft. Es wird um 21 Uhr gewesen sein. Total erschöpft nach 40 Kilometer Fußmarsch kamen wir in der Owersgasse an - aber glücklich, endlich am Ziel zu sein.
Für Vater, den wir zu Hause antrafen, war es eine riesige Überraschung. Wir waren ihm nämlich zuvorgekommen. Er hatte dieselbe Idee wie wir: Er wollte nach Reifferscheid kommen, um uns zurückzuholen, dorthin, wo wir hingehörten. Lange genug war die Familie getrennt. Und er war wohl auch des Alleinseins müde. Jeder strebte nach einem wieder allmählich einsetzenden normalen Leben. Aber von einem wirklich normalen Leben war die Bevölkerung noch weit entfernt. Es sollte noch Jahre dauern, bis alles wieder normal war. Und bis dahin gab es noch eine schwere Zeit - mit viel Hunger und Not.
Wann wir an diesem Abend zu Bett gegangen sind, weiß ich heute nicht mehr. Obwohl es beiderseits sicher viel zu erzählen gab, sind wir - so denke ich mir - wegen der körperlichen Erschöpfung wohl bald gegangen; am nächsten Tag hatten wir sicher Zeit genug, uns alles zu erzählen.
Als wichtigste Nachricht erzählte mein Vater am nächsten Tag, es war der Mittwoch, daß er mit Johann Pörling (das war ein Schuhmacher, der in der Hochstraße in der Nachbarschaft wohnte) verabredet habe, am nächsten Tag (dem Donnerstag) nach Mayen zu fahren, um von dort aus zu Fuß Reifferscheid zu erreichen. Als er dies mit Pörlings Johann ausgemacht hatte, konnte er noch nicht wissen, daß wir inzwischen wieder in Neuendorf waren. Pörlings Johann verfügte - woher, das weiß ich nicht - über zwei Pferde mit Wagen. Er selbst stammte aus Minkelfeld und wollte, aus welchen Gründen auch immer, in den Bereich seiner Heimat. Meinem Vater schwebte vor, den Leiterwagen als Handwagen mitzunehmen und mit Hilfe dieses Wagens alle Kinder mit dem nötigsten Gepäck wieder nach Hause zu holen.
Der erste Eindruck von unserem Haus war nicht gerade überwältigend. Es sah sehr ramponiert aus. Ersatz- oder Drahtglas war in den Fenstern, weil immer noch alle Scheiben kaputt waren. Aber Vater hatte sich - wo er nur konnte - nützlich gemacht und repariert, so gut es ging. Und er hatte auch eine Menge neues Werkzeug. Mir war das aufgefallen, aber ich hatte keine Vorstellung, woher es war. Es stammte - wie er dann erzählte - aus Beständen der Deutschen Wehrmacht, und zwar aus dem sogenannten Pionierpark (ich wußte, daß es diesen gab), der sich am Kesselheimer Weg befand und sich ungefähr vom Umspannwerk der RWE-AG bis zum damaligen Kloster Maria Trost erstreckte. Hier gab es alles, was eine Pioniereinheit brauchte, und alles war von der Deutschen Wehrmacht auf ihrem Rückzug vor den Amerikanern zurückgelassen worden. Noch bevor die Amerikaner eingerückt waren, hatte die Bevölkerung von Wallersheim, Neuendorf und Lützel (vielleicht auch von dem nahen Bubenheim oder Rübenach) das Lager total geräumt. Vor allem die Bauern, die über Zugtiere - meist Pferde - mit Wagen verfügten, schleppten nach Hause und füllten sich die Scheunen - egal, ob sie es brauchen konnten oder nicht. Für meinen Vater, der ähnliche Überlegungen hatte, war dies mit dem Handwagen natürlich schwieriger. Und zum Zeitpunkt, als dies geschah, konnte wohl noch niemand wissen, daß man das Gerät später auch gut gebrauchen konnte, um Tauschgeschäfte zu machen.
Was gab es hier alles: Gartengeräte wie Spaten und Hacken in allen Ausführungen, Sensen, Sicheln, Maschendrahtrollen und dazu gehörende Holzpfosten, Krampen zum befestigen das Drahts, Äxte, Hämmer, Zangen aller Art, Holzbohlen, Seile, Seilwinden, Schrauben und Nägel. Es muß gewesen sein wie im Schlaraffenland. Alles wurde aus dem Lager geräumt, und eine Menge davon war auch bei uns zu Hause. Derartiges Werkzeug und Material konnte Vater gut gebrauchen.
Am nächsten Tag - es war der Donnerstag - brachen Vater und Mutter mit ihrem Handwagen und mit Hilfe von Johann Pörling in aller Frühe auf. Ich selbst war für einige Tage auf mich allein gestellt. Ich denke, daß mich die Nachbarn, Urmetzers, während dieser Zeit "versorgt" haben - ich weiß es heute nicht mehr, wie es wirklich gewesen ist. Urmetzers, das waren die Nachbarn, in deren Luftschutzkeller sich unsere Mädchen aufhielten, als im November zuvor Koblenz in Schutt und Asche gelegt worden war. Für meine Mutter war die Tour nach Reifferscheid bestimmt eine Tortur. Nur einen Tag hatte sie Zeit, um nach einem langen, zweitägigen Fußmarsch von etwa 60 Kilometern zu regenerieren. Sie war zu dieser Zeit gerade 42 Jahre alt und wird trotzdem froh gewesen sein, mit der günstigen Gelegenheit der Mitnahme nach Mayen ihre Familie wieder zusammenführen zu können.
Es war eine verrückte Zeit, die Zeit des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches. Der Krieg war noch nicht vorbei. Irgendwo in Mitteldeutschland gab es noch Kampfhandlungen, insbesondere um Berlin. Und dort, wo die Westmächte deutsches Land schon erobert hatten, da war relativer Frieden. Es gab eine unendliche Bevölkerungsbewegung. Die Menschen war unterwegs - zu Fuß und manchmal auf die abenteuerlichste Weise, um wieder nach Hause zu kommen. Von Nord nach Süd und von Ost nach West (hin und wieder auch umgekehrt). Gerade aus Thüringen und Sachsen kamen vor allem die Koblenzer zurück, die in den letzten Kriegsmonaten dorthin evakuiert worden waren, weil es in ihrer Heimatstadt wegen der dauernden Luftangriffe zu gefährlich für sie geworden war. Wir selbst kamen einer solchen Evakuierung ja zuvor, weil wir uns nach Reifferscheid zu unseren Verwandten abgemeldet hatten.
Am Dienstag darauf trafen meine Eltern mit Sack und Pack wieder in Neuendorf ein; mit meinen fünf Geschwistern und dem Leiterwagen voller Gegenstände, hauptsächlich Bettzeug. Ludwig, der jüngste, war noch keine drei Jahre alt. Deswegen wurde er während der ganzen Heimfahrt gezogen und geschoben: Er durfte oben auf dem Wagen sitzen. Auch meine jüngste Schwester Therese - sie war noch nicht sechs Jahre alt - durfte hin und wieder auf dem Wagen sitzen. Die anderen aber, Brigitte (elfeinhalb Jahre), Trudel (zehn) und Bernhard (noch nicht acht) sind - von Ausnahmen abgesehen - die Strecke zu Fuß gegangen. Gott sei dank war es nicht die gesamte Strecke von Reifferscheid aus, sondern erst ab Döttingen. Erna nämlich, die Cousine meiner Mutter (ich erwähnte sie bereits) sowie Walds Agnes aus der Reifferscheider Nachbarschaft (auch diese erwähnte ich schon. Agnes war die Schwester von Alois, der sich in den letzten Kriegstagen noch erfolgreich der Einberufung entziehen konnte und die Zweitälteste der Familie mit den neun Kindern) spannten die Pferde, die ihnen eigentlich nicht gehörten, an, luden meine Eltern mit meinen Geschwistern und dem vollgepackten Leiterwagen auf und fuhren mit ihnen über Honnerath, Adenau und Breidscheid bis nach Döttingen. Bis dahin war es schon eine gute Strecke, die die Heimkehrenden nicht zu Fuß bewältigen mußten. In Döttingen gab es zum Abschied noch ein Frühstück bei Onkel Josefs Bruder, und dann waren sie auf sich allein gestellt, während Erna und Agnes mit ihrem Fuhrwerk wieder nach Reifferscheid zurückfuhren.
Noch am selben Tag kamen die Wanderer bis Polch. Sie nahmen im wesentlichen denselben Weg, den eine Woche vorher meine Mutter schon einmal mit mir gegangen war. Vater und Mutter zogen oder schoben den Wagen, und das war nicht immer einfach, ging es doch über Berg und Tal, besonders der Anstieg hinter Virneburg nach Kreuznick war steil und deshalb beschwerlich. In Polch fanden sie einen mitfühlenden Bauern (so etwas gab es also auch), der der Familie erlaubte, in der Scheune zu übernachten. Einen Tag später - es war Dienstag, der 17. April 1945 - waren wir wieder vereint. In den Abendstunden dieses Tages erreichten alle Neuendorf. Ich war froh, daß sie wohlbehalten angekommen waren. Obwohl der Krieg auch an diesem Tag noch nicht beendet war, begann für uns eine neue Zeit. Es gab noch viel zu tun. Also packten wir's an.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Die Kunst des Überlebens nach dem Krieg
und die "Währungsreform"
(10) - Es begann eine Zeit der großen Veränderungen. Zumindest als Jugendlicher mußte ich das so empfinden. Vorbei war einerseits die ständige Angst wegen des Krieges, andererseits konnte jeder sein Leben neu ordnen. Infolge der vielen und zum Teil großen und größten Zerstörungen durch die Bombenangriffe hatte fast jede Familie damit zu tun, ihr Haus oder ihre Wohnung wieder in einen vernünftigen und menschenwürdigen Zustand zu versetzen. Dies war aber nicht so einfach. Viele verfügten nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel, und diejenigen, die noch genügend Geld hatten, konnten sich dafür auch nichts mehr kaufen.
Eine natürliche Staatsform gab es nach dem Zusammenbruch, was gleichbedeutend ist mit Kriegsende - Anfang Mai 1945 war das der Fall - auch nicht mehr. Es herrschte Besatzungsrecht. Die ersten Besatzer waren die Amerikaner. Später einigten sich die Siegermächte - Amerikaner, Briten, Franzosen und die Sowjetunion, das besiegte Deutschland unter sich aufzuteilen. Vier Zonen gab es danach. Koblenz und das Rheinland gehörten fortan zur französischen Zone. Die Amerikaner zogen sich folgerichtig zurück und die Franzosen übernahmen das Kommando. Der Alliierte Kontrollrat sorgte für die "Gesetzgebung", was bedeutete, daß das bis dahin geltende deutsche Recht weitgehend außer Kraft gesetzt und durch alliiertes Recht ersetzt wurde. In diesem Zusammenhang ließ auch die Versorgung der Bevölkerung nach. Vieles konnte man überhaupt nicht mehr kaufen - auch wenn man das Geld dafür gehabt hätte. Der Schwarzhandel blühte, zumal die Alliierten auch neues Geld eingeführt hatten; die deutsche Reichsmark gab es nicht mehr, und das alliierte Geld wollte niemand haben. Also wurde auf dem "Schwarzen Markt" getauscht: Ware gegen Ware. Wer nichts herzugeben hatte, konnte auch nichts bekommen. Der Schwarzhandel war zwar verboten und er wurde bestraft. Doch er blühte an allen Ecken.
Die Verknappung der Ernährungsgüter führte wiederum zu einer Art Völkerwanderung, wenn auch nicht in dem Maße, wie bei den Evakuierungsmaßnahmen und Flüchtlingsbewegungen aus dem Osten Deutschlands in den letzten Kriegsmonaten aus Furcht vor den Sowjets. Die Bevölkerung aus den Städten versuchte "auf dem Land"- bei den Bauern" etwas zu Essen" zu bekommen. Die Bauern nutzten diese Situation, die sie für sich selbst als günstig ansahen, zum großen Teil weidlich aus. Manch einer aus der Stadt gab fast seinen letzten beweglichen Besitz her, um Kartoffeln, Speck, Mehl, Öl oder Eier zu erhalten und um nicht verhungern zu müssen. Wir selbst hatten keinen Besitz, den wir hätten eintauschen können. Also mußten sich meine Eltern etwas anderes einfallen lassen. Denn daß es uns immer schlechter ging, war unübersehbar. Hungrig standen wir morgens auf, und oft gingen wir abends auch hungrig zu Bett. Meine Eltern litten sehr darunter, wenn sie sahen, daß ihre Kinder noch hungrig waren, sie ihnen aber nichts mehr geben konnten. Das führte dazu, daß die Mutter von allen am wenigsten bekam.
Wir wären sicher fast verhungert, wenn unser Vater nicht immer wieder einen Weg gefunden hätte, etwas Eßbares herbeizuschaffen. Wegen der Entfernung war er kurz nach dem Krieg vom Bahnhof Ehrenbreitstein zur Bahnmeisterei Lützel gewechselt. Das lag für ihn günstiger, und dadurch hatte er etwas mehr Zeit zur Verfügung, um Gartenarbeit zu verrichten. Neben unserem Garten am Wallersheimer Weg, den wir schon vor dem Krieg gepachtet hatten, pachtete er noch zwei weitere: Einen von Urmetzers, unseren Nachbarn, in der Gemarkung Schartwiese, das war in der Nähe des Badeplatzes unterhalb der Moselmündung, und einen am Kammertsweg in Wallersheim, in der Nähe der heutigen Öllager am Ölhafen in Richtung Kesselheim. Diesen Garten gaben wir später wieder ab und pachteten einen in der verlängerten Hochstraße zwischen Neuendorf und Wallersheim, weil dieser Garten erheblich günstiger war. Er lag nahe bei unserer Wohnung. Diese Gärten waren für uns die Grundlage der Ernährung. Denn hier konnte angepflanzt werden, was eine so große Familie wie die unsrige im Laufe eines Jahres zum Essen brauchte. Hauptsächlich wurden Kartoffeln angepflanzt. Aber auch alle Sorten Gemüse: Wirsing, Weiß- und Rotkohl, Krauskohl für den Winter, Spinat und mehrere Sorten Salat von Kopfsalat über Schnittsalat und Feldsalat (Mausohr) bis zum Endiviensalat, auch Zwiebeln und Schalotten. Parallel zu dieser Maßnahme wurde die Zahl der Hühner und Kaninchen erhöht und somit die Voraussetzung für die Versorgung mit Eiern und Fleisch geschaffen. Man kann sich denken, daß Vater die Arbeit unmöglich allein bewältigen konnte. Mutter half zwar im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch bei der Gartenarbeit mit, diese beschränkte sich aber hauptsächlich auf die Erntezeit. Ansonsten war ich gefragt.
Es war nicht nur, daß ich für die vielen Kaninchen - zeitweise hatten wir mehr als 50 davon - tagtäglich das Futter herbeischaffen mußte, was mehr und mehr zu einem Problem wurde, sondern auch bei der Gartenarbeit war ich täglich dabei. Das Futtersuchen war deshalb besonders schwierig geworden, weil wir einerseits erheblich mehr Kaninchen hatten als während des Krieges und andererseits jetzt fast jede Familie Kaninchen besaß und Futter suchen mußte, was dazu führte, daß man im Umkreis von zehn Kilometern - bis an die Grenzen von Rübenach und Urmitz - nicht einen einzigen Löwenzahn mehr fand. Folglich war ich gezwungen, auf die Felder der Bauern auszuweichen; wie man sich denken kann, nicht zu deren Freude. Aber es blieb mir nichts anderes übrig, als in deren Kleefeldern zu mähen. Erwischen lassen durfte ich mich nicht. Gewissermaßen als moralischen Beistand fuhr ich selten allein zum Futterholen. Meistens waren Freunde, vor allem Willi Thone, Hans Zenz und Hans Kleemann, dabei. Gemeinsam waren wir - falls wir einmal erwischt wurden - stärker. Das glaubten wir jedenfalls. Und hin und wieder erwies sich unsere Annahme auch als richtig.
Im Garten gab es immer etwas zu tun. Umspaten und hacken, Unkraut entfernen waren die Hauptarbeiten. Aber auch Mist und Gülle fahren. Das war eine unendliche Arbeit. 150 Liter gingen in ein Faß, und eine einfache Strecke betrug fast zwei Kilometer zum Garten im Wallersheimer Weg. Zu den beiden übrigen Gärten war der Weg etwas kürzer. Bis zu sechs Fahrten an einem Tag war keine Seltenheit. Gerade das war eine Arbeit, die ich überhaupt nicht gerne verrichtete. Sie wurde nur noch übertroffen von "Kartoffelkäfer raffen". Gemeint war das Suchen und Entfernen des Koloradokäfers, der die Kartoffelpflanzen in der Blütezeit befiel und großen Schaden anrichtete. Es dauerte Stunden um Stunden, wenn man in jeder Kartoffelreihe Pflanze für Pflanze von oben und von unten untersuchen mußte, um insbesondere die Käferlarven, lachsrote madenförmige und übel riechende Larven, zu entfernen, die allein an der Pflanze fraßen. Natürlich galt es auch, die Käfer einzusammeln. Sie fraßen zwar nicht, aber sie legten ununterbrochen Eier. In der Bevölkerung erzählte man sich, der Kartoffelkäfer sei von den Amerikanern unter dem Gesichtspunkt der biologischen Kampfführung eingeführt worden, um die deutsche Ernährungswirtschaft zu schädigen. Im Herbst wurden die Kartoffeln ausgegraben. Bei der Masse, die wir angepflanzt hatten, war das eine unendliche Geschichte. Ich erinnere mich, daß wir in einem Jahr - es muß 1946 oder 1947 gewesen sein - 110 Zentner Kartoffeln verbrauchten. Das war mehr. als wir selbst geerntet und mit dem Leiterwagen - unserem Handwagen - nach Hause gefahren hatten. Den Rest gruben Vater und ich auf abgeernteten Feldern der Bauern noch aus. Unser Keller war bis an die Decke mit Kartoffeln gefüllt. Oft gab es mangels Brot bereits zum Frühstück Bratkartoffeln. Diese waren nur mit wenig Fett zubereitet, was wir von unseren Kaninchen zum Teil selbst gewonnen hatten.
Bei der Zubereitung von Fett hatte die Mutter eine eigene Philosophie. Sie nahm Nierenfett vom Rind und Schweineschmalz, dazu das aus dem Flomen der geschlachteten Kaninchen ausgelassene Fett und schmolz alles zusammen zu gleichen Teilen ein. Der ausgelassene Flomen war ebenfalls geeignet zum Braten von Kartoffeln oder zur Verbesserung von Suppen.
Fett war im übrigen in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein äußerst begehrtes Lebensmittel, wofür unsere Mutter hin und wieder nach Reifferscheid fuhr, um dort neben Fett auch Öl. Schinken und Mehl zu besorgen. Das war aber erst dann wieder möglich, als die durch Kriegseinwirkungen zerstörten Schienenwege wiederhergestellt waren. An zwei sich wiederholende Ereignisse erinnere ich mich noch sehr genau, weil sie vor allem für meine Mutter unmöglich schienen. Sie hatte von Reifferscheid jeweils eine Flasche Rüböl (das war das Öl, welches die Bauern - ich habe bereits darauf hingewiesen - aus von ihnen selbst angepflanztem Raps gewannen) mitgebracht, und zwar war es jedesmal eine Flasche mit einem sogenannten Bügelverschluß. Dieser Verschluß war sehr dicht, und man brauchte nicht zu befürchten, daß sich der Korken löst. Diese Flasche stand im kleinen Zimmer auf einem vertico-ähnlichen Schrank. Zweimal ist es geschehen, daß eines Morgens die Flasche in sich zusammengebrochen auf dem Schrank lag und das gesamte wertvolle Öl ausgelaufen war. Mutter hatte dabei den Verdacht geäußert, jemand von den Kindern hätte die Flasche zerbrochen und traue sich nicht, dies zuzugeben. Viel später sind wir dahinter gekommen, daß es am Verschluß lag, der die Flaschen zerbrechen ließ. Das Öl dehnte sich - temperaturbedingt - aus, und da ein Korken nicht wegfliegen konnte, sondern die Flasche fest verschlossen war, sprengte der innere Druck das Glas. Es war jedesmal ein herber Verlust. Später wurden solche Flaschen nur noch mit einem Korken verschlossen.
In den Zeiten der Not - das waren die Jahre ab dem Kriegsende im Mai 1945 bis zur Währungsreform im Juni 1948 - war es natürlich von Vorteil, daß man selbst über einige Reserven verfügte, mit denen man die kargen Lebensmittelzuteilungen erweitern konnte. An erster Stelle waren dafür unsere Hühner und Kaninchen gut. Täglich verfügten wir über frische Eier, und es gab Zeiten, da schlachtete Vater alle zwei Wochen einen Stallhasen, der uns am Sonntag mit köstlichem Frischfleisch und im übrigen mit Fett versorgte. Selbst die Felle konnten wir verwerten. Vater reinigte sie immer, bevor er sie aufspannte. So konnte er sie im getrockneten Zustand verkaufen. Der Erlös war zwar gering, aber es war trotzdem mehr als gar nichts.
In einem Jahr - es wird 1946 oder 1947 gewesen sein - hatten wir Gelegenheit, vermehrt Fische auf den Speiseplan zu bringen. Die Heranwachsenden des Neuendorfer Unterdorfs, allen voran mein Schulkamerad und Nachbar Willi Wagner aus der Schmitzgasse, waren wie elektrisiert. In Scharen zogen die kleinen Weißfische - "Scheele", wie wir sagten - unmittelbar am Ufer rheinaufwärts. Man hatte das Gefühl, man kann sie mit der Hand fangen. Das ging natürlich nicht so einfach. Also schnitten wir uns Haselnußgerten, befestigten Silk und eine Angel daran und gingen fischen. Ein Problem waren die notwendigen Köder. Diese mußten weiß sein, damit man sie sehen konnte. Speck war das Richtige, aber woher Speck bekommen? Schließlich ließen sich unsere Mütter erweichen; denn wir brauchten je nur ein ganz kleines Stück davon. Mit diesem primitiven Angelzeug fischten wir. Wir sahen den Speck und konnten sehen, wie die Fische danach schnappten. Auf diese Weise zog jeder täglich ... zig Fische aus dem Rhein. Willi Wagner beherrschte es am besten. Einmal schaffte er es, binnen weniger Stunden 84 Fische an Land zu ziehen. Nach einigen Tagen ließ das Interesse aber nach, vor allem, weil unsere Mütter allmählich nicht mehr wußten, was sie mit den Fischen machen sollten. Jeden Tag grätenreichen Fisch, das wollte auch keiner mehr. Die Mütter hatten sie schon in Essig- und Zwiebellake eingelegt (so hielten sie sich länger), aber auch das hatte irgendwie eine Grenze.
Für das tägliche Brot verließen wir uns nicht nur auf das Vater-unser-Gebet. Es muß in den Jahren 1946 und 1947 gewesen sein, als ich selbst mit meinem Freund Willi Thone während der großen Sommerferien mit dem Fahrrad bis in den Großraum Karmelenberg bei Ochtendung fuhr, um dort Ähren zu lesen. Das war über eine Zeit von jeweils etwa zwei Wochen ein hartes Stück Arbeit. Die einfache Entfernung zum betrug 20 bis 25 Kilometer, wobei es ausgangs Metternich steil aufwärts ging, und wir das Fahrrad nur schieben konnten. Gelesen wurde auf den riesigen Weizenfeldern, die wohl alle zu den beiden großen Höfen - Karmelenberger Hof und Achterspanner Hof - gehörten. Es war für uns vorteilhaft, wenn die Garben bereits von den Feldern abgefahren waren. So kamen wir nicht in Verdacht, die Ähren, statt sie aufzulesen, aus den Garben geschnitten zu haben. Es war täglich eine mühsame Arbeit über mehrere Stunden, um einen Sack zu füllen. Zu Hause mußte der Weizen noch gedroschen und von der Spreu getrennt werden. Ein Sack Ähren ergab ungefähr 25 Pfund Körner. Im Laufe des Sommers werden auf diese Weise wohl eineinhalb bis zwei Zentner zusammengekommen sein. Ich erinnere mich, daß wir, Willi und ich, eines Tages in der Nähe des Karmelenberger Hofes von dem Bauer angehalten und gezwungen worden sind, den fast vollen Sack auf dem Feld auszuschütten, weil er angenommen hat, wir hätten die Ähren von den noch auf dem Feld stehenden Garben genommen. Das war ein herber Schlag: Fast einen ganzen Tag Arbeit für nichts! Da wir das nicht einsehen konnten, taten wir, als führen wir mit unseren Fahrrädern weg. Nach einer gewissen Entfernung hielten wir jedoch an und schlichen uns zu Fuß zurück zu dem Feld. Dort füllten wir in aller Eile unsere Säcke wieder mit den zuvor ausgeschütteten Ähren und retteten auf diese Weise den Lohn unserer Arbeit. Mit dem gedroschenen Weizen hatten wir aber noch lange kein Brot. Die langweiligste Arbeit stand uns noch bevor. Wir hatten Glück insoweit, als Vater eine Mühle beschaffen konnte, die wesentlich größer war als eine Kaffeemühle. Man stelle sich vor, die gesamte Frucht hätte auf der Kaffeemühle gemahlen werden müssen. Glück hatten wir aber auch, weil wir mehrere Kinder hatten, und deshalb nicht einer allein den gesamten Weizen mahlen mußte. Eine Mühle durchzumahlen dauerte etwa eine Stunde. Und wir brauchten mehrere Mühlen, um genügend Schrot für ein Brot zu bekommen. Es war also geschrotetes Brot, das Mutter im Backofen des Küchenherdes backte. Richtiges Mehl konnte auf der Mühle nicht gemahlen werden.
Richtiges Mehl gab es aber manchmal trotzdem. Und was für ein Mehl! Schneeweiß war es und in Säcken zu 25 Kilogramm gepackt. Aus Amerika stammte es und war ein Teil des Versorgungsplans, den die Amerikaner nach dem Krieg ersonnen und umgesetzt hatten. Marshall-Plan hieß er. Mit Hilfe dieses Plans wurde eine bessere Versorgung der deutschen Bevölkerung sichergestellt. Hauptnutznießer waren jedoch die Bewohner der damaligen amerikanischen Besatzungszone. Wir aber gehörten zur französischen Besatzungszone und bekamen nichts. Aber die Züge, mit denen die Güter von den Nordseehäfen in den Süden Deutschlands transportiert wurden, fuhren durch Koblenz. Und unser Vater war bei der Bahn. Und den Bahn-Leuten fiel in diesem Zusammenhang einiges ein.
Über Kanäle, die mir immer unbekannt geblieben sind, wußten die "Bähner", wie die bei der Bahn beschäftigten Personen genannt wurden, immer, wenn ein solcher Zug Lützel passierte. Und was transportierten diese Züge nicht alles an wertvollen Ernährungsgütern. Es gab Mehl, Kakaopulver, Schokolade, Erdnußbutter, Trockenmilch, Trockenhefe - ja sogar Eier wurden auf diese Weise transportiert. Es war nicht legal, wie die Bähner an die Lebensmittel herankamen. Aber was war in dieser Zeit schon legal, wenn es darum ging zu überleben? Also: Es erfolgte eine Absprache mit dem zuständigen Stellwerk. Das Stellwerk ließ das Durchfahrtsignal für zwei bis drei Minuten auf „halt" stehen, so daß der Zug gezwungen war, anzuhalten. Die "auf der Lauer liegenden Bähner - die Züge fuhren immer nachts - sprangen mit Bolzenschneidern "bewaffnet" aus ihrer Deckung, durchschnitten die Plomben der Wagen, öffneten die Türen und warfen, ohne nachzusehen, um welche Güter es sich handelte, die Kisten und Pakete ins Freie. Alles mußte blitzschnell und möglichst lautlos geschehen; denn nach der kurzen Haltezeit wurde über das Signal „freie Fahrt" gegeben. Wenn der Zug anrollte, mußten alle Türen wieder verschlossen und die Aktionen beendet sein. Erst jetzt konnte man feststellen, was man eigentlich "erbeutet" hatte. Einmal war die Überraschung groß und das ganze eine große Schmiererei, weil frische Eier aus dem Waggon geworfen worden waren. Und trotzdem gab es noch welche, die dabei heil geblieben sind. Von allem erhielt der „Mann im Stellwerk" einen Anteil, weil nur durch seine Mithilfe die Aktionen möglich waren.
An einem anderen Morgen weckte mich mein Vater - es war noch dunkel - mit dem Hinweis, es gäbe Butter. Mit unserem Handwagen machten wir uns auf, um die Sachen abzuholen. Der Weg war weit. Bis zur „Mayener Bahn" mußten wir gehen. Das war in der Nähe des Klosters Maria Trost, vorbei am schon erwähnten ehemaligen „Pionierpark", dort, wo die Bahnstrecke nach Mayen von der linksrheinischen Bahnstrecke im Bereich des Verschiebebahnhofs Koblenz-Lützel abzweigt. Sechs Kartons hatte mein Vater reserviert. Und in jedem Karton waren sechs große Dosen mit einem Inhalt von je vier Litern. Die Enttäuschung war zu Hause jedoch sehr groß, als wir nach dem öffnen einer Dose feststellten, daß nicht Butter - wie erwartet - der Inhalt war, sondern eine braune zähe Masse, die wir zunächst nicht identifizieren konnten. Ich kannte den Geruch nicht. Nach längeren Überlegungen meinten meine Eltern, es rieche nach Erdnüssen. Auch Erdnüsse kannte ich nicht. Auf den Dosen stand „Peanut-Butter". Mit meinen geringen Englischkenntnissen wußte ich: Pea heißt Erbse, Nut heißt Nuß. Über den Begriff „Erbsnuß" stellten die Eltern dann fest, es müsse sich um „Erdnuß-Butter" handeln. Und diese Annahme war zutreffend. Es war zwar nicht die erhoffte Butter, aber die Erdnußbutter war trotzdem für uns von großem Vorteil. Mutter verwertete sie, wo sie nur konnte. In der Suppe, in Streuseln auf dem Streuselkuchen, den wir uns (wenn Mehl aus den Zügen genommen werden konnte) ab und zu leisten konnten. Ja, selbst Kartoffeln briet Mutter hin und wieder mit der Erdnußbutter, die hauptsächlich aber als Brotaufstrich diente.
Noch etwas anderes gab es, was Vater von der Bahn besorgte: Briketts. Nach dem Krieg herrschte auch Mangel an Kohlen und Briketts. Heizung gab es nur in wenigen Häusern; und da wo es sie einmal gab, war sie meistens zerstört oder noch nicht wieder hergestellt. Aber auch Koks gab es ja nicht. Gas- oder Ölheizung kannte man zu dieser Zeit überhaupt noch nicht. Viele Menschen froren in ihren Wohnungen, zumal viele Fenster noch nicht wieder ordnungsgemäß hergestellt waren. Es zog an allen Ecken und Enden. Unmittelbar nach dem Krieg - erinnere ich mich - habe ich mit meinem ehemaligen Freund Karl aus der Handwerkerstraße am Neuendorfer Eck -da befand sich der Badestrand vor einem kleinen Akazienwäldchen - einen Baum gefällt, um Heizmaterial zu erhalten. Briketts also brachte mein Vater von der Arbeit mit. Damals war er als „Sicherheitsposten" an der Bahnstrecke im Bereich der Mosel-Eisenbahnbrücke eingeteilt. Das bedeutete, daß er mit einem Signalhorn die Streckenarbeiter vor herannahenden Zügen warnen mußte. Die Moselbrücke war nur notdürftig wiederhergestellt. Es war gar keine Brücke im eigentlichen Sinne; denn eine seitliche Konstruktion gab es nicht. Es standen nur einfachste Pfeiler in der Mosel, und über die Pfeiler waren die Gleise verlegt - ohne jeden Unterbau - von den Schwellen abgesehen. Es sah gefährlich aus, wenn die Züge darüber fuhren und diese durften nur ganz langsam die Brücke passieren. Auch Kohle-Züge gehörten dazu. Auf diesen Zügen gab es Waggons, die mit Briketts hoch beladen waren. Mit einem langen, oben wie ein Krückstock gebogenen Eisenrohr konnte man Briketts von den vorbeifahrenden Zügen herunterholen. Das war zwar auch verboten, aber die Bahnpolizei sah im entscheidenden Augenblick nicht hin; war sie doch sicher, daß sie selbst auch einen Anteil von den Briketts bekam.
So wie mein Freund Karl und ich einmal einen Baum im Akazienwäldchen gefällt hatten, taten dies auch andere Leute. Dies führte dazu, daß viele Wurzeln in der Erde waren, deren Oberteil abgeschnitten war. Meinem Vater war die Arbeit nicht zu schwer, auch solche Wurzeln auszugraben, um zusätzliches Brennmaterial zu gewinnen. Ich half ihm dabei. Es war eine entsetzliche Arbeit. Nicht nur das Ausgraben selbst, vor allem das Aufladen der schweren Wurzeln auf den Leiterwagen - alles per Hand - war sehr mühsam. Die Wurzeln waren so schwer und groß, daß jeweils nur eine auf den Wagen geladen werden konnte. Und was war es erst für eine Arbeit, diese zu zerkleinern. Nur mit Hilfe von Eisenkeilen und Vorschlaghammer -beides stammte aus dem schon erwähnten Pionierpark - war dies möglich.
Einen weiteren Beitrag zur Familien-Ernährung (wenn auch einen weniger wichtigen) möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil auch dieser zu meinen Aufgaben gehörte. Im Spätsommer, wenn die Äpfel reif wurden, fuhr ich mit der Fähre über den Rhein nach Urbar, um Äpfel (Fallobst) zu sammeln, aus denen Mutter Apfelkompott für den Winter herstellte. Es war auch zu den Äpfeln ein weiter Weg, der durch Urbar, vorbei am heutigen Sportplatz in Richtung Niederberg/Arenberg führte. Links dieser Straße, gegenüber der Kaserne, gab es sehr viele Apfelbäume. Es geschah nur selten, daß ich nicht genügend Fallobst fand. Dann half ich etwas nach. Es war immer ein Sack mittlerer Größe mit ungefähr 50 bis 60 Pfund Inhalt, den ich füllte und anschließend auf den Schultern nach Hause trug. Das war recht mühsam, aber auf dem Rückweg ging es zum Glück fast nur bergab.
Ich erwähnte in diesem Kapitel sowie in Kapitel 2 bereits, daß wir zu Hause meistens nur über wenig Geld verfügen konnten und daß es uns gerade von 1945 bis 1948 wirtschaftlich besonders schlecht ging. Einen kleinen Beitrag konnte ich in geldlicher Hinsicht dadurch leisten, daß ich einmal in der Woche abends Kegeln aufsetzte. Die Kegelbahn ist heute noch im Gasthof Prümm vorhanden. Damals gab es noch keine automatischen Kegelbahnen; die Arbeit war recht mühsam und immer in einer stickigen Luft. Trotzdem machte ich die Arbeit gerne, weil ich nach Beendigung des offiziellen Klubkegelns immer noch ein paar Kugeln selbst werfen durfte. Auf diese Weise habe ich im Laufe der Jahre eine gewisse Fertigkeit erlangt, die mir später, als ich im Jahre 1960 erstmals selbst einem Kegelklub beitrat, sehr von Nutzen war. Also für den Abend (das war immer von 20 bis 23 Uhr) bekam ich unmittelbar nach Kriegsende vier Mark, später hat der Klub fünf Mark bezahlt. Ich habe dieses Geld - auch nicht teilweise - nicht für mich behalten, sondern immer in voller Höhe meiner Mutter als Beitrag zum Lebensunterhalt gegeben.
Einige Jahre später, ab Herbst 1949 bis weit in das Jahr 1950 hinein, unterstützte ich die Eltern mit dem Lohn, den ich für eine Arbeit beim TOTO bekam. Jakob Schäfer aus dem Nauweg, der rechte Verteidiger der berühmten TuS-Mannschaft, hatte, wie andere TuS-Spieler auch, eine Fernwettstelle. Diese befand sich in den Räumen der heutigen Gastwirtschaft „Zum Häs'chen". Hier mußte hauptsächlich nachts gearbeitet werden. Daneben ging ich noch bis Ostern 1950 zur Schule und befand mich also gewissermaßen in der Endphase, kurz vor der Mittleren Reife. Das war für mich eine große Belastung. Doch ich war andererseits froh, meine Eltern unterstützen zu können. Die Arbeit bestand im wesentlichen im Schreiben von Anschriften auf Briefumschläge, mit denen die Wettscheine verschickt wurden. Hierzu muß man wissen, daß es in der Anfangsphase des TOTO-Geschäftes noch nicht in ganz Deutschland Wettbüros gab. Robert Weinand, der damalige Präsident von TuS Neuendorf (derselbe, der während des Krieges Leiter des Wirtschaftsamtes der Stadt Koblenz war), war der Initiator der TOTO-Gesellschaften überhaupt. TOTO gab es also zuerst nur in Rheinland-Pfalz. Viele der damaligen Spieler von TuS Neuendorf hatten solche Fernwettstellen. Jakob Schäfers Büro war hauptsächlich für Süddeutschland zuständig. Das Einzugsgebiet erstreckte sich vom Allgäu im Südwesten bis zur Oberpfalz an der tschechischen Grenze. Hunderte von Ortsnamen sind aus der damaligen Zeit in meinem Gedächtnis haften geblieben. Von den meisten wußte ich nach einer Einarbeitungszeit sogar die Postleitzahlen, die zu dieser Zeit jedoch nach einem anderen System geführt wurden. Die für das Wettbüro geltenden Postleitzahlen waren vor allem 13a und 13b sowie 14a und 14b.
Als ich nach dem Schulabschluß mit der Mittleren Reife eine Lehrstelle beim Landratsamt des damaligen Landkreises Koblenz-Land erhielt (ich werde noch darauf zurückkommen), blieb ich nur noch kurze Zeit beim TOTO, weil die Belastung auf Dauer zu groß war.
Trotz aller Belastungen, die mit dem Zuhause und der Schule zusammenhingen, gab es natürlich auch freie Zeiten, um zu spielen oder den eigenen Interessen nachgehen zu können. So hielten wir uns unmittelbar nach dem Krieg auf einem Schleppkahn auf, der durch Kriegseinwirkungen schwer beschädigt worden war und unterhalb von Neuendorf, nicht weit vom Ufer entfernt, auf Grund lag. Es gab fast keinen Jungen aus dem Unterdorf, der sich nicht mit den Planken des Schiffes und den Balken, auf denen diese auflagen, ein kleines Floß baute. Die Planken wurden einfach auf zwei oder drei Balken genagelt, und dann konnte man mit diesem Floß fahren. Nägel hatte fast jeder; sie stammten aus dem bereits in Kapitel 8 erwähnten Pionierpark. Mit einer Handvoll Nägel und einem Hammer in der anderen Hand schwamm jeder an das Schiff; zurück konnte man dann selber fahren, nachdem man sein neues Floß zu Wasser gelassen hatte. Auf das Floß stellte jeder einen Fußschemel, damit man sitzen konnte und paddelte los - mit einem Paddel, das meist nichts anderes als eine Latte war. Diese kleinen Flöße waren richtig "seetüchtig", sogar über den Rhein nach Urbar sind wir damit gefahren, und eine ganze Flotte davon lag am Neuendorfer Unterdorf "vor Anker".
Natürlich sind wir - vor allem im Sommer 1945 - nicht immer nur mit diesen Flößen gefahren. Auch viel geschwommen sind wir im Rhein, der damals erheblich sauberer war als heute. Niemand hat daran gedacht, man könnte durch verschmutztes Wasser krank werden. Weil damals nur die wenigsten Häuser oder Wohnungen über ein Bad verfügten, nahmen viele Männer ihr wöchentliches Reinigungsbad samstags mit Seife und Bürste im Rhein. Die Jungen in Neuendorf konnten alle gut schwimmen. Es war für sie - aber auch für einige Mädchen - überhaupt kein Problem, über den Rhein zu schwimmen. Dabei wurden wir jedoch infolge der Strömung erheblich abgetrieben. Am Badeplatz ins Wasser gestiegen, kam man kurz vor Urbar an das andere Ufer. Um zurück zu schwimmen, mußten wir sodann wieder bis fast nach Ehrenbreitstein rheinaufwärts gehen, um etwa an der Neuendorfer Kirche wieder das eigene Ufer zu erreichen. Wenn uns der Sinn danach stand, schwammen wir auch zweimal an einem Tag über den Rhein und zurück.
Vor den Neuendorfer Rheinwiesen lag ein zweiter Schleppkahn auf Grund. Da die Strömung an dieser Stelle nicht so stark war, wie unterhalb von Neuendorf und außerdem genügend Wassertiefe vorhanden war, tummelten sich hier bei schönem Sommerwetter scharenweise die Jugendlichen, zumal der Weg dorthin für jeden sehr nahe war. Hier übten wir Kopfsprünge, die die meisten fast perfekt beherrschten, was vor allem dann von Vorteil war, wenn wir manchmal am Neuendorfer Badestrand über die Mosel schwammen und dann von den großen Steinpollern am Deutschen Eck kopfüber in die Mosel sprangen. Je nach Wasserstand betrug die Höhe des Sprungs bis zu sechs Meter,' und nicht jeder traute sich, da hinunter zu springen.
Eine Attraktion war das "Wasserfahrzeug", mit dem Hans Kleemann eines Tages seine Freunde und die Neuendorfer Jugend überraschte. Sein Vater hatte ihm das gebaut; es war aus Blech und ursprünglich einmal ein Benzintank eines Flugzeugs, das dieses, als der Tank leer war, wohl abgeworfen hatte. In den Tank hatte Hans' Vater oben eine Öffnung geschnitten, so daß zwei Personen hintereinander Platz nehmen konnten. Das Fahrzeug glich einer großen Zigarre. An einem Samstag fuhren Willi Thone und Reinhold Glotzbach mit diesem Boot und wollten an einem zu Berg fahrenden Schleppkahn festmachen. Dieses Vorhaben mißlang, und die beiden kollidierten mit dem am Schleppkahn hängenden Nachen. Die beiden kenterten, die "Flugzeugzigarre" ging unter; denn sie hatte keinen Luftkasten, und Willi und Reinhold konnten sich nur schwimmend an den folgenden Schleppkahn retten. Besser wäre gewesen, sie hätten sich schwimmend ans Ufer gerettet. Nun saßen sie aber auf dem Schleppkahn fest, der bei seiner Fahrt immer mehr auf das Ehrenbreitsteiner Ufer zusteuerte. Warum die beiden nicht von Bord gingen, wußten sie nachher selbst nicht mehr zu sagen. Tatsache ist aber, daß sie bis nach Niederlahnstein auf dem Kahn blieben, dann erst ins Wasser sprangen und am Deutschen Eck über die Mosel zurück nach Neuendorf schwammen. Es wird für sie nicht leicht gewesen sein, Hans Kleemann zu erklären, daß sein Boot inzwischen auf dem Grunde des Rheins liegt. Bei dieser Gelegenheit ist auch mein eigener Autoreifen, der aus Sicherheitsgründen immer in dem Boot lag, verloren gegangen.
Später sind wir hin und wieder mit einem anderen Fahrzeug gefahren. Otto Krämer besaß einen Zweisitzer-Kanadier und deshalb hat er immer, wenn er unterwegs war, einen anderen Jungen mitgenommen. Mit diesem Boot sind wir manchmal auch auf die Insel Niederwerth gefahren.
Im Jahre 1949 gab es ein außergewöhnlich warmes Frühjahr. Es war so wann, daß die Clique beschloß, mit Booten auf die Insel Niederwerth zu
Ostermontag, 18. April 1949, auf Niederwerth mit (von links):
obere Reihe: Willi Thone, Otto Krämer, Josef Krämer, Günter Radermacher,
ich selbst, Toni Kraeber;
untere Reihe: Toni Regenberg, Hans Kleemann, Hans Weller.
fahren. Dort gingen wir Ostermontag erstmals in diesem Jahr baden. Das Wasser war zwar noch etwas frisch, besonders weil es sich um Rhein-Wasser (nicht das aus der Mosel hinzufließende Wasser, das immer etwas wärmer war) handelte, aber für ein paar Schwimmzüge war es doch ganz gut.
Weniger gut war die Idee - ich weiß nicht, wer sie gehabt hat, auf den Mast der Hochspannungsleitung zu klettern, der bekanntlich auf der Niederwerther Südspitze steht. Immerhin ist dieser Mast 121 Meter hoch und trägt die zweimal 380 Kilovolt-Leitung, die von Wallersheim über den Rhein nach Urbar führt. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt, wenn auch nicht jeder das Risiko einging. Ich selbst bin mitgeklettert, und zwar - wie einige andere auch - bis in die Mastspitze, bis unmittelbar unter die Erdungsleitung, die von der RWE-AG betriebsintern auch als Telefonleitung benutzt wird. Es war zunächst gar nicht so einfach, die fest installierte Leiter zu erreichen, die aus Sicherheitsgründen natürlich nicht für jeden ohne weiteres zugänglich ist. Aber diese Erschwernis haben wir auch gemeistert. Heute kann ich sagen, daß Gott sei Dank niemand etwas geschehen ist. Die, die oben waren, kehrten alle heil wieder zur Erde zurück - auch die, welche schon auf halbem Wege umgekehrt sind. Ich weiß aber noch, daß Günter Radermacher bei der ganzen Aktion an allen Ballen beider Innenhände Blasen bekommen hat, die natürlich schmerzten. Vielleicht hat er die Leitersprossen nicht so gegriffen, wie es nötig gewesen wäre. Ich selbst hatte keine Blasen, obwohl ich sonst, wenn ich auch nur einen Besenstiel in der Hand habe, schon nach zwei Minuten Blasen bekomme.
* * *
Die Situation der Schule in den ersten Nachkriegsjahren
(11) - In den Schulen lag bei Kriegsende die Bildungsarbeit brach. Erst im Oktober 1945 wurde der Schulbetrieb in dem teilzerstörten und nur notdürftig reparierten Gebäude der Hohenzollernschule wieder aufgenommen. Die Mädchen der Mittelschule mußten wegen ihres zerstörten Schulgebäudes in der Thielenstraße in dem Gebäude der Mittelschule für Jungen aufgenommen werden, weshalb der Schulbetrieb über den ganzen Tag verteilt war. Es gab also Unterricht sowohl am Vor- als auch am Nachmittag. Schulbücher gab es noch nicht. Und auch Lehrer waren nicht ausreichend vorhanden; viele waren entweder im Krieg gefallen oder noch in Gefangenschaft. So wundert es nicht, daß nicht alle Fächer unterrichtet werden konnten. Physik, Chemie, Maschinenschreiben, Stenografie, Zeichnen, Musik und Turnen gab es zunächst überhaupt nicht und später nur eingeschränkt. Auch der Geschichtsunterricht war auf Befehl der französischen Militärregierung lange Zeit verboten.
In dem Gebäude war die Heizungsanlage noch nicht wieder instandgesetzt, und die Fenster schlossen nicht dicht. Kalt war es deshalb im Winter 1945/46. Wie die Schulverwaltung es geschafft hat, kleine Öfen für die Klassenräume zu organisieren, deren Abgasrohre meist durch die Fensteröffnungen geführt werden mußten, weil nicht Kamine in ausreichender Zahl vorhanden waren, weiß ich nicht. Ich erinnere mich aber, daß die Schüler - wollten sie es nicht allzu kalt in ihren Klassenräumen haben - gezwungen waren, selbst für Heizmaterial zu sorgen. Meistens brachten die Schüler täglich ein Brikett mit, um einigermaßen warm zu sitzen.
Pausenbrote wie sie sonst üblich waren, hatten die meisten Schüler wegen der schlechten Versorgungslage nicht oder nicht ausreichend. Es war deshalb ein Segen, daß ausländische Hilfsorganisationen hier helfend einsprangen. Da gab es die amerikanische "Quäker-Speise" und das "Schweizer Hilfswerk". Die Quäker sorgten dafür, daß in den Pausen ein Imbiß zur Verfügung stand. Meistens gab es Kakao oder Milch mit Zwieback oder Brötchen für jeden Schüler. Und das Schweizer Hilfswerk errichtete auf dem Clemensplatz, da, wo sich heute der Regierungsparkplatz befindet, Baracken, die beheizt wurden. Dorthin konnten die Schüler in der Mittagszeit gehen, und sie erhielten hier täglich eine warme Suppe. Beide Unterstützungen wurden nicht nur von den Schülern, sondern auch von deren Eltern dankbar entgegengenommen.
Und was hatten wir für Lehrer oder Lehrerinnen! Es gab welche, die waren hervorragend ausgebildet, bei denen konnte man viel lernen. An erster Stelle erinnere ich mich an unsere zeitweilige Klassenlehrerin, Fräulein Eugenie Napp aus St. Goar, die uns in Mathematik, Englisch und Französisch hervorragend unterrichtete. "Mathematik ist eine exakte Wissenschaft und nur etwas für helle Köpfe", pflegte sie immer zu sagen. Es tat mir leid, daß sie irgendwann nicht mehr unsere Lehrerin war. Sie war immer streng, aber auch gerecht. Strenge Lehrer waren auch Lux, Theobald und Schradin. Dem Deutschlehrer Hanns Maria Lux verdanke ich mein heutiges Interesse an Dichtung und Lyrik. Er war zwar nicht allen Schülern angenehm. Einige bedauerten, daß er mehr Literaturwissenschaft als die deutsche Sprache vermittelte. Hanns Maria Lux war Saarländer und hatte vor vielen Jahren den Text des Saarliedes "Deutsch ist die Saar ..." geschrieben, wie er sich auch als Autor von Büchern und Geschichten hervortat. Wegen dieses Saarliedes ist er nach dem Krieg von den Franzosen für mehrere Monate inhaftiert worden. Während seiner Haftzeit hat er Weihnachtsgedichte geschrieben und später auch veröffentlicht. Bei Theobald hatten wir später Mathematik und Erdkunde. Mit diesem Lehrer kam ich nicht besonders zurecht. Als skurillen Erzieher empfand die ganze Klasse den Erdkunde- und späteren Musiklehrer Heinrich Nellen. Der Mann hatte viel bei uns auszuhalten; wir spielten ihm Streiche, wo wir nur konnten, weil er sich nicht durchsetzen konnte. Oft rannte er wütend aus der Klasse und kam später mit der Frage zurück, ob wir "wieder gut sein" wollten. Heute bedauere ich, daß wir diesen Lehrer so oft geärgert hatten. Er war von Natur aus ein sehr zugänglicher und lieber Lehrer. Wenn man ihm ganz normal begegnete, war er die Freundlichkeit in Person. Als Erdkundelehrer hatte er die Eigenheit, daß er, wenn er Länder durchnahm, immer verlangte, Städte in Verbindung mit Flüssen zu nennen. So forderte er zum Beispiel bei den Hauptstädten Italiens oder Spaniens als Antwort nicht nur Rom oder Madrid, sondern Rom am Tiber oder Madrid am Manzanares. Welcher Schüler oder Erwachsene weiß heute überhaupt, daß Madrid am Manzanares liegt. Oder anders gefragt: Wer kennt einen Fluß mit diesem Namen? Dank dieser oder ähnlicher "Forderungen" des Lehrers bin ich noch heute in der Lage, beispielsweise die Hauptflüsse Hinterindiens oder Sibiriens oder die Landschaften des Peleponnes in der richtigen Folge aufzuzählen. Manch einer wird diese Methode für stupide halten. Ich selbst habe eine Menge dabei gelernt - und nicht vergessen.
Unseren damals kommissarischen Schulleiter, Lehrer Theodor Bomm, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Er unterrichtete uns zuletzt in Mathematik, Englisch und Französisch. Er war ein Lehrer mit hohen moralischen Ansprüchen und unser Klassenlehrer.
Die Abschlußklasse der Realschule Koblenz im Jahre 1950 mit
Lehrer Theodor Bomm
Manchmal legte ich mich mit ihm an. Ich war nämlich Klassensprecher seit der Quinta (heute sagt man "sechste Klasse") und war dadurch nicht nur Mittler zwischen Lehrer und Schüler, sondern hatte auch die Interessen der Schüler zu vertreten. Es ist verständlich, daß ihm nicht alles gefiel, was ich in dieser Eigenschaft zu sagen hatte. Ich denke, daß es heute auch nicht anders ist. Irgendwann einmal muß er wohl "die Nase voll gehabt haben"; denn er forderte "Neuwahlen" des Klassensprechers. Ich selbst hatte davor keine Angst. Aber es bewarben sich noch zwei andere Schüler, einen davon hätte Lehrer Bomm gerne als Klassensprecher gesehen. Und so kam es zur Wahl. 28 Schüler stimmten ab. Ein Bewerber erhielt eine Stimme (vielleicht war es seine eigene), der "Günstling" erhielt drei Stimmen, und die übrigen 24 Schüler (ich selbst natürlich auch) gaben mir ihre Stimme. Lehrer Bomm war sauer, aber er respektierte die Wahl. Ich habe ihm dieses demokratische Verhalten hoch angerechnet. Er hätte nicht wählen lassen müssen, sondern bestimmen können (damals war das noch so). Immerhin bemühte ich mich fortan um ein besseres Miteinander. Er hat es mir auch nicht nachgetragen und wir sind bis zum Schulabschluß sehr gut miteinander ausgekommen.
Zu erwähnen ist auch noch eine schulische Eigenheit, die es meines Wissens nur in der französischen Besatzungszone gab, nämlich die Umstellung des üblichen Notensystems auf ein Punktesystem für die Beurteilung von Leistungen. Die Umstellung erfolgte 1948. Anstelle von Note 1 (sehr gut) bis Note 6 (ungenügend) gab es nach der Einführung durch die französische Besatzungsbehörde 20 Punkte für sehr gut bis 0 Punkte für ungenügend. Zum Beispiel gab es für die bisherige Note befriedigend elf, zwölf oder 13 Punkte. Ich selbst fand das System gar nicht so schlecht und bin insgesamt sehr gut damit zurechtgekommen.
* * *
Gefangenen- und Internierungslager - und gefährliche Munitionsfunde
(12) - Ein düsteres Nachkriegskapitel waren die Gefangenenlager, welche die Besatzungsmächte unterhielten. Ich selbst habe zwei davon wahrgenommen. Ein sehr großes Lager befand sich zwischen Sinzig und Remagen, in dem die gefangenen deutschen Soldaten ohne Unterkünfte unter freiem Himmel kampierten, dort lebten und schliefen, ihre Notdurft verrichteten und fast nichts zu essen bekamen. Viele sind hier elend zu Grunde gegangen, an Unterernährung, Krankheit oder Erfrierungen im Winter 1945/46. Das Lager war berüchtigt für seine Unmenschlichkeit. Nicht umsonst ist in der Nähe ein Soldatenfriedhof entstanden und später eine große Gedenkstätte.
Das andere Lager habe ich besser kennengelernt. Auch dieses war ein großes Lager. Es befand sich auf dem heutigen Gelände der Falkensteinkaserne in Lützel und erstreckte sich links der Bundesstraße 9 in Richtung Köln bis zur schon im vorletzten Kapitel erwähnten Mayener Bahn, dort, wo sich heute das Lkw-Werk von Mercedes befindet. In der Tiefe reichte es bis zur Bubenheimer Straße in Metternich, umfaßte also das gesamte Pollenfeld, das ich schon im Kapitel 8 erwähnt habe. Auch hier ging es den gefangenen Soldaten sehr schlecht. Die Koblenzer Bevölkerung hatte aber Mitleid mit ihnen und organisierte einen Hilfsdienst. Einen solchen gab es auch in Neuendorf unter der Federführung des katholischen Pfarrers. Dieser mobilisierte vor allem die Landwirte, aber auch die anderen Familien, etwas für die Soldaten zu tun und sie mit Bekleidung und Ernährungsgütern zu unterstützen. Obwohl die Leute selbst nur wenig besaßen, leisteten sie großartige Hilfe. Kartoffeln, Obst und Gemüse, Brot sowie Bekleidung und Schuhe wurden über viele Wochen gesammelt und ins Lager transportiert, wofür die Bauern Fuhrwerke zur Verfügung stellten (entgegen der sonstigen Praxis taten sie hier einmal etwas für die Allgemeinheit). Ich bin oft mitgefahren, habe geholfen, die Güter zu sammeln, aufzuladen und im Lager abzuladen, was natürlich nur mit Einverständnis der damals noch amerikanischen Lagerleitung möglich war.
Zur gleichen Zeit half ich auch unseren Nachbarn, den Urmetzers. Es galt, die von Bomben während des Krieges verwüsteten Felder wieder in Ordnung zu bringen. Ein solches Feld mit mehreren Bombentrichtern befand sich im Gebiet zwischen der Bundesstraße 9 und der Bahnlinie im Bereich Lützel, direkt gegenüber dem Gefangenenlager, etwa dort, wo sich heute das Renault-Autohaus Schilling befindet. Der Weg zu diesem Feld führte unmittelbar am Gefangenenlager vorbei. Eines Tages ging auf der anderen Seite des Stacheldrahts (das Lager war natürlich rundum mit Stacheldraht eingezäunt) ein Trupp gefangener Soldaten unter militärischer Bewachung, als mir einer der Soldaten etwas zurief und auch etwas durch den Zaun nach außen warf. Natürlich ging ich zu dieser Stelle und hob es auf. Es war ein Briefumschlag mit einem Zettel, auf dem eine Adresse geschrieben war mit der Bitte, diese Adresse anzuschreiben, sobald die Post wieder befördert werde (das war zu dieser Zeit noch nicht möglich) und mitzuteilen, daß er - der Soldat - noch lebe und sich in Koblenz im Gefangenenlager befinde. Die Anschrift war eine weibliche Person im Bereich des heutigen Baden-Württemberg. Ich vermutete, daß es wohl die Ehefrau des Soldaten gewesen ist. An der Geschichte hatte ich aber keine große Freude; denn kurze Zeit später erschien einer der Bewacher - es war ein dunkelhäutiger amerikanische Soldat - auf dem Feld, auf dem wir arbeiteten, und forderte mich auf mitzukommen. Ich hatte ein ungutes Gefühl dabei. Er führte mich zur Lagerkommandantur. Dort wurde ich von mehreren Offizieren in Empfang genommen und befragt, was geschehen sei. Sie sprachen englisch mit mir und ich bemühte mich sehr, sie zu verstehen. Sie wollten wissen, was der Soldat mir zugeworfen und ich aufgehoben hätte und verlangten die Herausgabe. Offensichtlich konnte ich mich verständlich machen. Denn nach kurzer Zeit gaben sie mir den Zettel zurück und entließen mich. Natürlich machte ich mir Gedanken über den deutschen Soldat. Ich befürchtete, daß Sanktionen gegen ihn gerichtet würden. Als die Post ihren Dienst wieder aufnahm, schrieb ich sofort einen Brief an die mir angegebene Adresse und schilderte, was geschehen war. Meine Freude war groß, als nur ein paar Tage später ein Brief zurückkam, in dem der ehemals gefangene Soldat selbst mitteilte, daß er inzwischen entlassen und ihm damals nichts geschehen sei und er sich herzlich für meine Hilfe bedanke. Dafür legte er ein Paßbild von sich und einen Fünfmarkschein in den Brief Er erwähnte noch, daß er seinerseits sich große Gedanken um mich gemacht habe; denn er hätte gesehen, wie ich auf dem Feld abgeholt und ins Lager geführt worden sei.
Es gab auch noch eine andere Art von Lagern: Internierungslager. Hierhin brachten die Besatzungsbehörden die Deutschen, die politisch nicht einwandfrei schienen. Besonders die Mitglieder der "Hitler-Partei", der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter-Partei (NSdAP) wurden unter die Lupe genommen und ein sogenanntes "Entnazifizierungsverfahren" eingeleitet. Wer minder schwer belastet war, konnte bald wieder zurück nach Hause, die anderen blieben "inhaftiert".
Ein alter Bekannter unserer Familie, der schon erwähnte Glöckners Albert gehörte zum Kreis derer im Internierungslager, welches sich in der Nähe von Bad Kreuznach befand. Für die Familie war das eine schwere Belastung. Und so wurde mein Vater immer häufiger um Unterstützung gebeten, wenn es darum ging, in der Landwirtschaft zu helfen. Hatten Glöckners während des Krieges noch ein Pferd als Zugtier, stand ihnen nach dem Krieg nur ein Ochse zur Verfügung. Das aber war ein gewaltiges Tier. Ich glaube, er wog fast eine Tonne, war stark, stark wie - wie ein Ochse natürlich, und Vater hatte seine Arbeit mit ihm; denn der Ochse war sehr eigensinnig. Doch mein Vater ließ ihm nichts durchgehen. Er zwang ihn in die Schranken, wenn es nötig wurde - und es war oft nötig. Anders dagegen der Ochsen-Besitzer, Glöckners Albert. Es war schon fast komisch, was der Ochse hin und wieder mit ihm anstellte. Eine Geschichte empfinde ich besonders als erwähnenswert.
Für die Bauern der Koblenzer Stadtteile, Metternich, Neuendorf, Wallersheim, wo es besonders viele Bauern gab, stellte die Königsbacher Brauerei die Maische-Rückstände aus der Bierherstellung als Viehfutter zur Verfügung. Das kostete die Bauern nichts, außer sie mußten es selbst abholen. Es gab einen besonderen Verteilerplan, nach dem jeder Bauer regelmäßig an einem bestimmten Wochentag an der Reihe war. Immer wenn der Tag für Glöckners gekommen war, gab es Aufregung, und meistens wurde mein Vater zur Hilfe gerufen. Dem Chef, Glöckners Albert, gelang es nämlich fast nie, seinen Ochsen zum Gang zur Königsbach zu bewegen. Dieser ließ sich zwar noch einspannen, und er ging auch über die Moselbrücke, weiter durch die Weißergasse und durch die Fischelstraße (diese gibt es heute nicht mehr und führte zur Löhrstraße, auf die sie in Höhe des heutigen Kaufhofs mündete) bis zur Löhrstraße. Hier aber, wo er rechts in Richtung Königsbach hätte abbiegen müssen, ging der Ochse immer links herum und trabte die Löhrstraße hinunter (damals war das noch möglich) und wieder über die Moselbrücke nach Hause zurück. Albert konnte am Zügel ziehen oder die Peitsche benutzen wie er wollte; es half ihm nichts. Der Ochse bestimmte, wohin es ging. Saß mein Vater aber auf dem Wagen, bestimmte er, welche Richtung genommen wurde.
Zu den düsteren Kapiteln der Nachkriegszeit gehörte auch eine Begebenheit, die in Neuendorf viel Aufregung und Leid verursachte. Im Zuge des Rückmarsches hatten die deutschen Soldaten noch eine Menge Munition zurücklassen müssen. Und dies, obwohl die Wehrmacht in den letzten Monaten angeblich keine Munition mehr besaß, um den Krieg erfolgreich beenden zu können. Hier handelte es sich aber nicht um einfache Gewehrmunition, sondern um großkalibrige Granaten für Kanonen, Panzer oder Mörser. Es mag sein, daß dieses Gerät nicht mehr zur Verfügung stand und deshalb auch die Munition nicht mehr verwendet werden konnte.
Das Munitionslager befand sich an dem damaligen sogenannten Bubenheimer Berg. Das war an der Bundesstraße 9, etwa dort, wo sich heute das Verkehrskreuz Bundesstraße 9 - Bendorfer Brücke - Bundesautobahn 48 nach Trier befindet. Die heranwachsenden Jugendlichen - nicht nur aus Neuendorf - hatten das bald entdeckt und pilgerten in Scharen dorthin, um das Pulver aus den Kartuschen zu entnehmen. Das war nicht ungefährlich; denn die Kartuschen mußten mit Gewalt aufgeschlagen werden. Entnommen wurde das Pulver unterschiedlichster Art. Da gab es zum Beispiel lange Pulverröhrchen, die aussahen wie Makkaroni, nur schwarz waren sie, oder kleines, zylinderförmiges Pulver von etwa einem Zentimeter Länge und 0,6 Zentimeter Durchmesser. Darauf hatten es die Jugendlichen besonders abgesehen. Denn am Neuendorfer Ufer, auf dem Vorplatz des Sportplatzes - also auf der Kirmeswiese - machten sie sich einen Spaß daraus, dieses Pulver an einer Zigarette anzuzünden und sich gegenseitig damit zu bewerfen. Alle Warnungen der Erwachsenen schlugen sie in den Wind, bis eines Tages das Unglück geschah. Ein Junge, der zwei Jahre älter war als ich - Hans Kraeber hieß er und wohnte im Nauweg - hatte die Hosentasche voll solch kleinen Pulvers, als - wohl versehentlich - ein brennendes Pulverstück eines anderen Jungen genau in diese Hosentasche fiel. Hans Kraeber stand sofort in Flammen. Er wälzte sich am Boden und andere versuchten, das Feuer zu ersticken, was letztlich auch gelang. Aber der Junge war so schwer verletzt, daß er nach drei Tagen im Krankenhaus verstarb. Er war der Bruder meines Schulkameraden Toni Kraeber. Für die Mutter war dieses Ereignis besonders traurig, weil sie im November 1944 bei einem Bombenangriff auf Koblenz ihren Ehemann verloren hat. Im Keller eines zusammengestürzten Hauses in der Schlachthofstraße wurde er begraben und konnte nicht mehr lebend geborgen werden.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Allmähliche Rückkehr zur Normalität
(13) - Trotz der schlechten Wirtschafts- und Ernährungslage trat im gesellschaftlichen Bereich allmählich eine Besserung ein. Nach und nach kehrten die Menschen zu Dingen zurück, auf die sie während der Zeit des Hitler-Regimes ganz oder eingeschränkt verzichten mußten. Zwar gab es noch keinen kulturellen Höhenflug, aber erste Ansätze waren schon ab dem Jahre 1946 sichtbar. Im Kino standen nicht mehr nationalsozialistisch geprägte Filme und Wochenschauen auf dem Programm, auch die Theater konnten ihre Spielpläne wieder frei gestalten und unterlagen nicht mehr der Zensur der NSdAP. Wegen vieler seelischer Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, war manch einem auch nicht nach Konzert oder Musik zumute, dennoch wurden auch auf diesem Gebiet die wachsenden Angebote mehr und mehr angenommen. An Kirmes und Fastnacht konnten die jungen Leute - und es waren nicht nur junge - wieder zum Tanz gehen. Ich erinnere mich als Heranwachsender an die ersten solcher Veranstaltungen. Da es eine geordnete Gastronomie noch nicht gab, waren in den Tanzlokalen auch keine Tische mit Stühlen aufgestellt, sondern nur Bänke, die rund um die Tanzfläche an der Wand standen, wodurch sich natürlich eine riesige Tanzfläche ergab. Wer irgendwie ein Getränk organisieren konnte, brachte es einfach mit; für mitgebrachten Wein mußte Korkengeld bezahlt werden. In Neuendorf fanden die ersten Tanzveranstaltungen in der Turnhalle im Plankenweg statt, später auch im Saal der Metzgerei und Gastwirtschaft "Roter Ochsen".
Aber auch auf anderen Gebieten gab es einen Aufschwung. Viele Sportvereine und Verbände, vor allem Turnvereine, die im Dritten Reich zum Teil verboten waren, vor allem aber Jugendvereine und -Verbände begannen wieder mit der Arbeit. Besonders aktiv wurden die Vereine der Bündischen Jugend, darunter der Bund der Bund der deutschen Katholischen Jugend, die auch in Neuendorf eine Zelle schuf. Angeführt von unserem Schulkamerad Toni Regenberg gab es mit Unterstützung der Geistlichkeit die ersten Jugendgruppen - auch die Mädchen schlossen sich zu eigenen Gruppen zusammen. Jede Woche trafen wir uns in Gruppenstunden im Sälchen (das war ein kleiner Saal über der Sakristei im Kirchengebäude).
(Die "Ka-Ju"-Jugendgruppe im Februar 1949 im "Sälchen")
Dort wurden Lesungen gehalten, diskutiert, erzählt und gesungen. In allen Koblenzer Pfarreien bildeten sich solche Gruppen, in denen vor allem die Meßdiener meist die ersten "Mitglieder" waren. Im Laufe der Zeit bekamen die Neuendorfer besonders engen Kontakt zu den Jugendgruppen der städtischen Pfarreien St. Kastor und St. Josef. In St. Kastor wurde einmal im Monat eine abendliche Komplet für die Jugendgruppen aller Pfarreien der Stadt Koblenz veranstaltet, die immer sehr gut besucht war und man bei der Gelegenheit weitere Kontakte knüpfen konnte. Die Verbindung zu St. Josef ist wohl auf das Wirken des damaligen Stadtjugendseelsorgers Dr. Kurt Esser zurückzuführen, der in dieser Pfarrei wohnte und beruflich als Religionslehrer am Kaiserin-Augusta-Gymnasium (heute Görresgymnasium) beschäftigt war und neben der St.-Josef-Kirche wohnte. Dr. Esser war ein außergewöhnlich engagierter, guter und sehr beliebter Seelsorger, der in Koblenz höchstes Ansehen genoß, obwohl er auch nach damaliger Auffassung sehr progressiv und fortschrittlich war.
Viele Jahre lang - als er noch nicht über ein Auto verfügte - war er immer mit dem Fahrrad unterwegs, auch in jedem Jahr mindestens einmal als Verantwortlicher einer Rad-Wallfahrt der Koblenzer Jugend nach Bornhofen. Das Gesamtwerk Dr. Essers ist nach seinem Tod von
(Dr. Kurt Esser)
der Stadt Koblenz gewürdigt worden. Die Jugend-Begegnungsstätte im Markenbildchenweg gegenüber dem Hauptbahnhof hat den Namen "Dr.-Kurt-Esser-Haus" erhalten.
Bei und mit der Katholischen Jugend (sie wurde kurz KaJu genannt) gab es auch noch andere Aktionen. Noch heute erinnere ich mich gerne an die Zeltlager, die jedes Jahr an Pfingsten an einem zentralen Platz (zum Beispiel unterhalb der Burg Pyrmont im Elztal oder am Pulvermaar - beides in der Eifel) veranstaltet worden sind.
In der Jugendgruppe, der ich angehörte, war eigentlich immer etwas los. Neue Bekanntschaften und Freundschaften schlossen sich, Ausflüge mit dem Fahrrad wurden unternommen.
Die Räder, über die wir verfügten, waren natürlich nichts Besonderes. Sie waren zusammengeflickt - die Schläuche oftmals repariert und die Reifen meist unterlegt. Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Radtour, die uns über mehrere Tage durch die Vulkaneifel führte, und wir unterwegs nachts meist in Zelten schliefen. Es war im Sommer 1948, kurz nach der Währungsreform, als wir die Mosel aufwärts fuhren. Unser Ziel war der Weinort Ediger. Dort wohnte ein Onkel Otto Krämers. Er war Landwirt und Winzer, und wir hatten die Hoffnung, dort in der Scheune schlafen zu können. Spät war es, als wir am Zielort ankamen, obwohl wir den Cochemer Krampen nicht fuhren, sondern über den Berg abkürzten. Da ging es aber drei Kilometer nur bergauf, und wir mußten die Fahrräder schieben. Also, daß wir so spät ankamen, lag hauptsächlich an mir bzw. meinem maroden Fahrrad. An diesem ersten Tag hatte ich sechsmal einen "Platten" - und jedesmal am Hinterrad, was eine längere Montagezeit erforderte. Einen dieser Platten bekam ich, als wir die Fahrräder hinter Cochem den Berg hinauf schoben. Das Gelächter der anderen war groß aber für sie auch ärgerlich, weil sie jedesmal auf mich warten mußten. Ottos Onkel half mir aus der Patsche. Er verfügte noch über einen gebrauchten passenden Reifen, den er mir schenkte. In Manderscheid habe ich dann einen neuen Reifen gekauft, und fortan blieb ich von Pannen verschont.
Auch bildete sich ein Skat-Klub, nicht ein offizieller Verein, sondern eine Aktivität unter Freunden, die sich trafen, wenn sich die Gelegenheit bot. Toni Regenberg, Hans Kleemann, Gerd Breidbach, Willi Thone, Otto Krämer und ich selber spielten mal hier, mal dort. Manchmal, wenn der "dritte Mann" fehlte, wichen wir meistens zu Breidbachs aus (in Kapitel 2 habe ich das bereits erwähnt). Gerds Mutter spielte selbst ausgezeichnet Skat, und dann spielte sie mit uns. Darüber freute sie sich; denn sie hatte wenig Abwechslung; ihr Ehemann, Gerds Vater, war wenige Jahre zuvor verstorben.
Manchmal - aber nur an warmen Sommerabenden - hielt Toni Regenberg die Gruppenstunde im Glockenstuhl des Kirchturms ab. Das war immer sehr romantisch. Einmal stellten wir fest, daß Eulen oder Käuze (genau wußten wir das nicht) in der obersten Kirchturmspitze nisteten. Das brachte uns in Aufregung; denn wir wollten wissen, was es war. Also beschlossen wir, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich glaube, wir waren zu fünft, als wir über die Holzleitern im Innern des Turms nach ganz oben stiegen. Und dann hatten wir sie: Schleiereulen waren es, ein Altpaar mit vier schon flüggen Jungen. Wir räumten das ganze Nest aus - alle Eulen wanderten in den mitgebrachten Sack, und dann ging es durch Neuendorfs abendliche Straßen. Überall zeigten wir, was wir erbeutet hatten. Natürlich wollten wir die Eulen nicht behalten, sondern nur vorzeigen. In der Neuendorfer Bevölkerung ernteten wir großes Interesse. Jeder wollte wissen, wo die Eulen herkamen und was wir damit machen wollten. Nach einem etwa zweistündigen Rundgang durch unseren Ort ließen wir die Eulen, als wir zur Kirche zurückgekommen waren, wieder frei. Sie erhoben sich von unseren Händen geräuschlos und entschwanden in der Nacht. An den nächsten Tagen stellten wir erfreut fest, daß sie ihr altes Zuhause wieder angenommen hatten.
Die einschneidendste Maßnahme für mich aber war die Gründung einer Handballmannschaft. Toni Regenberg war es wieder, der die Idee mitbrachte; denn auch in anderen Koblenzer Pfarreien gab es dieselben Initiativen. Das war für Neuendorf etwas besonderes, galt Neuendorf doch als reines Fußballdorf. Die erste Mannschaft des Vereins TuS Neuendorf hatte in Deutschland schon einen guten Namen, und wer erinnert sich nicht gerne an die Spieler Gauchel, Schäfer, Oden, Ahlbach, Miltz, Warth, Hilgert, Unkelbach, Oster und wie sie alle hießen - aber auch an die großen internationalen und nationalen Begegnungen auf dem Oberwerth, so die ewigen Zweikämpfe mit dem großen Rivalen 1. FC Kaiserslautern mit den Gebrüdern Fritz und Otmar Walter. Im Jahre 1947 war es, als die Handballmannschaft der Katholischen Jugend in Neuendorf gegründet worden ist. Unserem Alter entsprechend handelte es sich um eine B-Jugend-Mannschaft; denn wir waren alle 15 oder 16 Jahre alt, und ich gehörte dazu.
* * *
Meine Vorliebe für den Handballsport
(14) - Nach der Gründung der Handballmannschaft trainierten wir fleißig. Wo wir die Bälle her bekamen, erinnere ich mich nicht, wohl aber daran, das Hans Weller privat einen Ball hatte, den er zur Verfügung stellte. Nach einigen Wochen kam es zum ersten Spiel. In Neuendorf erwarteten wir die Mannschaft der Katholischen Jugend St. Kastor. Unsere Mannschaft war hoch überlegen und gewann deutlich mit 11:1 Toren. Wenn wir ein Spiel auswärts austragen mußten, gingen wir entweder zu Fuß oder fuhren mit dem Fahrrad. Turnschuhe mußten wir - soweit es überhaupt welche gab - uns selbst kaufen. Und als Trikot trugen wir eine schwarze Hose und ein weißes Unterhemd. Unsere Gegner waren in der ersten Zeit vorwiegend Mannschaften der Katholischen Jugend. Solche gab es neben St. Kastor in den Pfarreien St. Elisabeth und St. Josef. Später versuchten wir es auch gegen Vereinsmannschaften. So spielten wir zunächst gegen den TV Güls, den SV Niederberg und den TV Ehrenbreitstein. Als Mannschaft der Katholischen Jugend Neuendorf bestritten wir insgesamt 19 Spiele, davon gewannen wir 16, ein Spiel endete unentschieden und nur zwei Spiele haben wir verloren. Hierbei erzielten wir ein Torverhältnis von 134:79.
Durch die Erfolge aufmerksam geworden, beeilte sich auch der Verein TuS Neuendorf, eine Handballmannschaft aufzustellen. Diese Mannschaft war aber nicht so erfolgreich wie die Jugendmannschaft der KaJu. Ich weiß heute nicht mehr, wer später die verhängnisvolle Idee hatte, als Jugendmannschaft von TuS Neuendorf (in der Zwischenzeit waren wir geschlossen zu TuS Neuendorf übergewechselt) gegen die eigene Erste Mannschaft anzutreten. Zwischen beiden Mannschaften gab es eine gewisse Rivalität. Die Jugendmannschaft war jedenfalls erfolgreicher als die Erste. Und so kam es, wie es kommen mußte. Das denkwürdige Spiel fand am 10. Juli 1949 in Neuendorf statt. Nach einer 4:2-Halbzeitführung gewann die Jugendmannschaft schließlich mit 6:5 Toren (ich selbst hatte das Glück, beim Stande von 5:5 den Siegtreffer zu erzielen) nach einem erbitterten Kampf - es war der letzte der Ersten Mannschaft, die die Niederlage nicht verkraftete und sich unmittelbar danach selbst auflöste.
Bevor dies jedoch geschah, hatte die KaJu- und spätere TuS-Mannschaft doch noch einige Probleme, weil sie irgendwann auch gegen starke Mannschaften spielen mußte. Es kam uns wie eine Blamage vor, als wir erstmals gegen TuS Horchheim - damals eine der stärksten Jugendmannschaften - antraten und mit 2:17 Toren sang- und klanglos untergingen. Wir wußten überhaupt nicht, wie uns geschah und zweifelten erheblich an unserem Können. Im Rückspiel wollten wir es zwar besser machen, aber es kam noch schlimmer. Diesmal verloren wir mit 1:17 Toren. Diese "Schmach" wurde aber durch den 8:3-Sieg am 27. November 1949 ausgeglichen. Doch es kamen auch wieder bessere Zeiten. Nach meinen eigenen Aufzeichnungen bestritten wir als Jugendmannschaft in der Zeit vom 1. Januar 1948 bis 31. August 1950 insgesamt 49 Spiele (23 Heimspiele und 26 Auswärtsspiele). Hierbei errangen wir 39 Siege, zweimal spielten wir unentschieden und nur acht Spiele haben wir verloren. Dabei haben wir ein Gesamt-Torverhältnis von 367:200 bei 80:18 Punkten erzielt. Auch als wir altersmäßig in den Seniorenbereich gewechselt sind und als Erste Mannschaft von TuS Neuendorf spielten, waren wir weiterhin recht erfolgreich. Den höchsten Sieg landete die Neuendorfer Mannschaft mit 24:4 Toren am 14. Oktober 1951 in Braubach; dabei erzielte ich sieben Tore. Das war aber nicht meine höchste Ausbeute. Beim 24:6-Erfolg gegen Rot-Weiß Koblenz am 16. September 1951 war ich neunmal erfolgreich. Sieben Tore hintereinander (dabei in jeder Halbzeit einen "Hattrick") warf ich beim 13:8-Erfolg am 14. Mai 1950 in Güls. Aus der Kreisklasse sind wir bis zur Landesliga aufgestiegen. Hier blieben wir aber hängen und konnten in dieser Klasse nie die Meisterschaft erringen.
Da gab es nämlich eine Mannschaft, die noch stärker war als wir: TuS Holzheim bei Limburg an der Lahn. Erbitterte Kämpfe gab es stets gegen diese Mannschaft, und fast immer waren wir nur "zweiter Sieger". Es gibt Leute, die behaupten, das Spiel gegen Holzheim am 1. Mai 1952 sei das beste Spiel gewesen, das jemals in Neuendorf stattgefunden habe. Damals sahen 700 Zuschauer leider eine 5:7-Niederlage. Noch mehr Zuschauer hatte die Neuendorfer Jugend beim Bezirks-Pokalendspiel gegen den TV Bassenheim. Dieses fand am 15. Januar 1951 vor einer Begegnung der Ersten Fußballmannschaft im Stadion Oberwerth statt. Etwa zehn- bis zwölftausend Zuschauer mögen es gewesen sein, als die Neuendorfer Handball-Jugend mit 4:1 (2:0) Toren gewann.

(Handball-Jugendmannschaft nach dem 4:1-Sieg gegen TV Bassenheim)
Ich selbst spielte Handball bis zum Sommer 1957, als ich beruflich nach Altenkirchen versetzt worden bin. Dort spielte ich ein Jahr beim SV Fluterschen Fußball, weil es Handball nicht gab. Im Jahre 1963 habe ich meine aktive sportliche Laufbahn beendet. Im Handballsport hatte ich bis dahin ausschließlich Feldhandball gespielt und gehörte als Stürmer immer zu den erfolgreichsten Spielern. Als in den 50er und 60er Jahren nach und nach zuerst Kleinfeldhandball und später Hallenhandball immer mehr Zuspruch fand, hat mich das Spiel wegen der Enge des Spielfeldes nicht mehr gereizt.
Trotzdem war ich dem Handballsport nicht fremd. Auf Drängen des damaligen Sportredakteurs Hartmut K. Lachmann von der Rhein-Post begann ich schon im Jahre 1950 als freier Mitarbeiter dieser Zeitung und schrieb Handballberichte. Ein Jahr später bin ich im Bezirk RHEIN des Handballverbandes Rheinland zum Pressewart gewählt worden. 1959 wechselte ich als Berichterstatter zur Rhein-Zeitung. Bis 1978 habe ich für diese Zeitung gearbeitet und gleichzeitig das Amt des Verbandspressewartes aufgegeben, welches ich im Jahre 1974 übernommen hatte. Danach war ich bis 1988 noch Vorsitzender der Technischen Kommission des Handballverbandes Rheinland und heute - seit 1967 - "nur noch" Redakteur des Mitteilungsblattes Rheinlandhandball, das der Handballverband herausgibt.
* * *
(15) - Im vorletzten Kapitel habe ich die Gründung von Gruppen der Katholischen Jugend erwähnt. Diese Gruppen führten zu einem besseren Zusammenhalt der Jugendlichen, nicht nur in den einzelnen Gruppen, sondern auch in den Gruppen untereinander; ja noch weitergehender: Auch die Gruppen der beiden Geschlechter, die grundsätzlich getrennt arbeiteten, bekamen mehr Kontakt zueinander. Das lag nicht nur an den Räumlichkeiten, in denen die Gruppen sich trafen - wenn auch jeweils zu anderen Zeiten, sicher auch an dem fortschreitenden Alter in der Pubertät, daß nach und nach mehr Interesse am jeweils anderen Geschlecht bestand. So ist es nicht verwunderlich, vielmehr zwangsläufig, daß sich Zellen bildeten, denen Jugendliche verschiedener Gruppen beider Geschlechter angehörten. Für mich und meine Freunde war die Bildung einer solchen Zelle verhältnismäßig einfach. Einerseits hatte ich in Willi Thone und Hans Kleemann sowohl einen Freund als auch Schulkameraden. Beide hatten eine Zwillingsschwester und bei Hans Kleemann arbeiteten wir in einer Gemeinschaft bei unseren Schulaufgaben zusammen, und zwar in einer kleinen Hütte, die bei kalter Witterung beheizbar war. Auch Hans Zenz gehörte dieser Arbeitsgemeinschaft an, mit der wir uns fast täglich nachmittags trafen. Im Wohnbereich von Hans Kleemann gab es außerdem einen großen ehemaligen Büroraum des ehemaligen Konfitüren-Herstellers Zander, bei dem Hans Kleemanns Vater als Kraftfahrer beschäftigt war. Außerdem war es ein glücklicher Umstand, daß Willi Thone die Ziehharmonika spielen konnte. Nur wird man auf den ersten Blick kaum erraten können, wie und wieso dies alles zusammenhängt. Aber es gab eine Verbindung.
An erster Stelle kam der Wunsch der beiden Zwillingsschwestem Marianne Kleemann und Maria Thone - und mit ihnen drei weitere Mädchen, tanzen zu lernen. Dafür mußte man aber einen Übungsraum, Musik und vor allem einen Partner haben.
So kam es wie es kommen mußte. Übungsraum war das ehemalige Büro, für die Musik sorgte Willi Tone und als Partner - was lag wohl näher - kamen die Freunde von Willi Thone und Hans Kleemann in Frage. Und dazu gehörte auch ich. Wir lernten also tanzen, ohne Tanzschule, autodidakt. Keiner von den Teilnehmern dieser Gruppe hat auch später jemals eine Tanzschule besucht.
Die Partnerschaft innerhalb dieser Gruppe übertrug sich auch auf die Gruppenabende bei der Katholischen Jugend, so daß mit der Zeit die gesamte "Clique" nicht nur größer wurde, personell hin und wieder sich veränderte, sondern auch viele andere Dinge gemeinsam unternommen wurden. Der Tanzkreis war nur der Anfang. Im Sommer gingen wir gemeinsam schwimmen, unternahmen Radtouren, im Rahmen der KaJu wurde gemeinsam Theater gespielt - im Jugendheim, das wegen Baufälligkeit inzwischen abgerissen worden ist, die bereits zitierte monatliche Komplet in St. Kastor besucht und manchmal - vor allem an lauen Sommerabenden - machten wir nach den Gruppenstunden der KaJu auch das Dorf "unsicher". Hierunter kann jeder verstehen, was er will. Später feierten wir auch Kirmes und Karneval gemeinsam. Als Nebeneffekt bildete sich aus dieser Gruppe ebenso der bereits zitierte Skat-Klub, der sich vor allem bei Gerd Breidbach, Otto Krämer, Toni Regenberg oder Willi Thone traf. Mancher Schabernack wurde dabei ausgeheckt. Einen will ich hier erzählen, obwohl es mir wegen meiner heutigen Skrupel nicht ganz leicht fällt.
In Neuendorf gab es zu dieser Zeit bereits wieder eine intakte Straßenbeleuchtung mit Stadtgas. Wir wußten, daß bei Erschütterungen diese Lampen die Eigenschaft hatten zu erlöschen. Das machten wir uns zunutze. Und so kam es, daß eines Abends in Neuendorf mit unserer Nachhilfe alles dunkel war, obwohl die Lampen vorher geleuchtet hatten. Niemand der Einwohner hatte eine Erklärung hierfür. Einen Nebeneffekt gab es am folgenden Morgen. In dem Zeitpunkt, als im übrigen Koblenz alle Straßenlaternen erloschen, gingen in Neuendorf die Laternen an und leuchteten am hellen Tag bis ein Arbeiter der Energieversorgung, der dafür eigens nach Neuendorf kommen mußte, alle Laternen von Hand löschte.
In jener Zeit, als Mädchen in meinen Lebenskreis traten, war meine Mutter besonders wach. Ich merkte, wie sie beobachtete, was wir machten. Heute empfinde ich es als wohltuend, daß sie sich weitgehend zurückgehalten hat mit Geboten oder Verboten. Aber oft hat sie mir Hinweise oder Ratschläge gegeben, die natürlich aus ihrer Sicht einen moralischen Hintergrund hatten. Doch niemals hatte ich eine Zeit-Auflage wegen des abendlichen Nach-Hause-Kommens. Ich räume allerdings ein, daß ich die Mutter in dieser Hinsicht nicht enttäuscht und sie weitgehend verstanden habe.
Über Sexualität wurde in unserer Familie so gut wie nie gesprochen. Dieses Thema haben wir aber hin und wieder in den Gruppenstunden der KaJu behandelt, an denen manchmal auch der Kaplan teilnahm. Dabei haben wir auch über Empfängnisverhütung gesprochen. Aus kirchlicher Sicht gab es nur eine Möglichkeit: "Knauss-Ogino", die Beachtung der fruchtbaren oder unfruchtbaren Tage der Frau. Hierüber habe ich mich auch mit meiner Mutter unterhalten.
Und jetzt komme ich zurück auf die Aussage in Artikel 2, nach der meine Mutter nicht kirchenhörig gewesen ist. Bei diesem Thema wurde sie nämlich sehr ärgerlich. Nicht über das Thema, sondern gerade über die Kirche. Sie erklärte mir, daß es bei der bekannten Armut in der Familie keineswegs ihr Wunsch gewesen sei, sechs Kinder zu haben. Aber die Kirche habe den Eheleuten noch in den dreißiger Jahren immer versichert, daß die Frau nur in der Mitte zwischen zwei Perioden n i c h t empfängnisbereit sei. Heute wisse sie, daß es genau umgekehrt sei, und das habe die Kirche bereits damals gewußt. Die Eheleute seien - wohl um mehr Kinder zu bekommen - damals von der Kirche bewußt getäuscht und belogen worden. Dieses Verhalten hat meine Mutter der Kirche niemals verziehen. Sie betonte aber gleichzeitig, daß sie, nachdem die Kinder einmal auf der Welt seien, sie natürlich nicht auf auch nur eines verzichten wolle.
Auch bei anderer Gelegenheit rückte sie von kirchlichen Auffassungen ab; so zum Beispiel bei der Frage nach Marien-Wallfahrten. Sie berief sich hierbei auf ihre Großmutter und hatte deren Auffassung übernommen: Zur Mutter-Gottes-Verehrung bedürfe es keiner Wallfahrten, sagte sie. Diese Verehrung könne auch zu Hause oder in der eigenen Pfarrkirche praktiziert werden. Ich stelle fest, daß ich selbst mir diese Auffassung ebenfalls zueigen gemacht habe und nicht viel von Wallfahrten oder auch Prozessionen halte. Überhaupt bin ich kein Freund von "großen Menschen-Aufläufen". Deshalb gehe ich seit Jahren nicht mehr zu großen Sportveranstaltungen und nehme auch nicht an Prozessionen, Demonstrationen oder Kundgebungen teil.
* * *
"Singe, wem Gesang gegeben"
(16) - Nicht erinnern kann ich mich heute daran, was der Grund gewesen ist, daß mein Freund Willi Thone und ich uns entschlossen haben, Mitglied im Männergesangverein 1856 Neuendorf zu werden. Vielleicht lag der Grund in der Tatsache, daß ich dem Singkreis der Katholischen Jugend der Stadt Koblenz angehörte, der von Hans Jander geleitet wurde. Dieser Singkreis hatte einen so guten Ruf, daß der Südwestfunk in einem Jahr im Saal des Katholischen Lesevereins einmal Weihnachtslieder aufnahm und sie auch in einer eigenen Sendung ausstrahlte.
Leiter des Männer-Chores war zu dieser Zeit Generalmusikdirektor Pfeiffer, ein schon nicht mehr junger Mann, aber ein Könner in seinem Fach. Er reihte Willi Thone in den 1. Baß und mich in den 2. Tenor ein. Eigentlich machte uns das Singen Spaß. Wir gingen regelmäßig zu den Proben, nahmen an Wettstreiten und Freundschaftssingen teil und entschlossen uns sogar später, auch dem Kirchenchor St. Peter Neuendorf beizutreten. Wenn ich heute vergleiche, in welchem Chor es mir besser gefallen hat, komme ich zu der Feststellung, daß ich den Kirchenchor besser fand. "Besser" ist relativ. Nicht daß der Männer-Chor keine Güte gehabt hätte, im Gegenteil. Der Männer-Chor war ein renommiertes Ensemble mit großer gesanglicher Qualität und hohem Ansehen. Mit "besser" möchte ich vielmehr zum Ausdruck bringen, daß ich einen gemischten Chor stimmlich angenehmer fand. Leiter des Kirchenchores war damals der Neuendorfer Organist Hans Kreuz, ein junger Mann aus Kettig, der sehr begabt schien. Dieser Chorleiter hat Monate später, nachdem GMD Pfeiffer aus Altersgründen nicht mehr arbeiten wollte, auch die Leitung des Männergesangvereins übernommen. In beiden Chören sind zum Teil recht schwierige Lieder und Chöre gesungen worden. Am liebsten waren mir im Kirchenchor Motetten. Großen Erfolg hatten wir aber auch mit achtstimmigen großen Chorgesängen, wie zum Beispiel Georg Friedrich Händels Messias oder Messen von Mozart und Bruckner.
Irgendwann bin ich zuerst aus dem Männergesangverein ausgeschieden, weil ich mit dem neuen Chorleiter Kreuz nicht zurecht gekommen bin.
Ich war nicht der einzige; denn auch andere Mitglieder kamen mit ihm nicht zurecht und kündigten die Mitgliedschaft, was letzten Endes dazu führte, daß Kreuz die Leitung abgeben mußte. Im Kirchenchor bahnte sich eine ähnliche Entwicklung an, so daß ich später auch aus diesem Chor ausschied, obwohl mir der Gesang sehr viel Freude bereitet hatte.
Seitdem bin ich nicht mehr aktives Mitglied in einem Gesangverein gewesen. Dem Männergesangverein Neuhäusel gehöre ich jedoch als inaktives (heute sagt man "förderndes") Mitglied seit 1962 an.
zurück zur Inhalts-Übersicht
* * *
Start in einen Beruf und Marlies tritt in mein Leben
(17) - Neben all diesen Aktivitäten durfte ich jedoch die Schule nicht vergessen. Mitarbeit zu Hause, Kegeln aufsetzen, zeitweise nachts beim TOTO, Handball, Gesangvereine, Jugendgruppen - und Schule. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das damals zeitlich alles bewältigt habe. Die Schule nahm mich jedenfalls in den beiden letzten Jahren vor der Mittleren Reife stark in Anspruch. Ich erinnere mich, daß ich fast jeden Tag bis abends Hausaufgaben machte oder sonstwie für die Schule arbeitete. Neben allem stellte sich auch mehr und mehr die Frage, wie es nach der Schule weitergehen sollte; denn zu jener Zeit war es ähnlich wie heute: Ausbildungsplätze gab es zu wenig.
Aber dann hatte ich es doch geschafft. Am 29. März 1950 - knapp zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag - erhielt ich das Zeugnis der Mittleren Reife. Durch einen glücklichen Umstand hatte es sich ergeben, daß ich mich schon im Februar bei der Bezirksregierung Koblenz um eine Eingangsstelle für die gehobene Beamten-Laufbahn hatte bewerben können. Die entsprechende zweijährige Lehrzeit mußte ich jedoch beim damaligen Landratsamt des Landkreises Koblenz-Land absolvieren, wo ich am 15. Mai 1950 begann und fortan auch die Berufsschule besuchen mußte. Im ersten Lehrjahr erhielt ich eine Erziehungsbeihilfe von monatlich 25 Deutsche Mark, im zweiten Lehrjahr eine solche von 35 Deutsche Mark. Das Lehrverhältnis wurde am 19. Mai 1952 beendet. Einen Tag später begann meine Tätigkeit bei der Bezirksregierung Koblenz.
Es war jedoch nicht die Tätigkeit, für die ich vorgesehen war. Denn auch im Jahre 1952 war die Arbeitsmarktlage genau so schlecht wie heute. In der Landesverwaltung bestand eine Einstellungssperre für den gehobenen Dienst. Man bot mir aber an, vorübergehend als Angestellter zu arbeiten, und zwar im Schreibdienst. Stenotypist sollte ich also werden. Notgedrungen nahm ich dieses Angebot an, nicht zuletzt, um etwas mehr Geld zu verdienen und bei der Bezirksregierung in die günstigere Verwaltung zu kommen. Voraussetzung für diese Tätigkeit war jedoch die Beherrschung von Stenografie und Schreibmaschine. Ersteres war kein Problem für mich, hatten wir die Kurzschrift doch in der Schule gelernt, und 120 Silben konnte ich durchaus schreiben. Was aber war mit Schreibmaschine? Das hatte ich bisher nicht gelernt. Um die geforderten 240 Anschläge pro Minute zu erreichen, mußte ich schon das Zehn-Finger-System beherrschen. Um es kurz zu machen. Es war eine Gewaltaktion. Nach einer mir von einem Kollegen überlassenen Vorlage brachte ich es binnen eines Monats auf die gewünschte Fertigkeit. Die entsprechende Prüfung bei der Bezirksregierung bestand ich und konnte deshalb die Tätigkeit dort beginnen. Diese Tätigkeit hat zwei Jahre gedauert, während dieser ich mit Stenogrammblock und Bleistift Diktate aufnehmen und anschließend auf der Schreibmaschine umsetzen mußte. Hierbei befand ich mich in guter Gesellschaft. Denn ich war nicht der einzige Bewerber auf einen Anwärterplatz für den gehobenen Dienst. Meinen beiden Kollegen Heinz-Josef Jung aus Horchheim und Berni Roth aus Moselweiß, die ich schon vom Handball her kannte, ging es ebenso. Und das wird wohl etwas Einmaliges bleiben. Heinz-Josef Jung hat später sogar die Chance gehabt, in den höheren Dienst aufzusteigen, in dem er es bis zum Abteilungsdirektor gebracht hat.
Im Jahre 1954 war es dann endlich soweit. Im Haushaltsplan waren Anwärterstellen ausgewiesen. Unter dieser Voraussetzung bin ich mit Wirkung vom 1. Mai "unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum Regierungsinspektor-Anwärter" ernannt worden.
Während der Anwärter-Zeit verlief die praktische Ausbildung in vielen Referaten der Bezirksregierung einschließlich Regierungshauptkasse, bei der Stadtverwaltung Koblenz, bei der Kreisverwaltung in Simmern/Hunsrück und beim Verwaltungsgericht Koblenz. Für die theoretische Ausbildung besuchten die Anwärter einmal wöchentlich ganztägig die Verwaltungsschule, die bei der Stadtverwaltung Koblenz eingerichtet war. Nach diesem System lernten die Anwärter nicht nur den Stoff als Vorbereitung auf die spätere Prüfung und Laufbahn, sondern auch die meisten Kolleginnen und Kollegen sowie Anwärter anderer Verwaltungen kennen, was für die spätere Arbeit von Vorteil war, weil man in diesen Kollegen bei anderen Verwaltungen immer eine Anlauf-Station hatte.
Am 26. und 27. Juni 1957 mußten wir nach dreijähriger Ausbildung zur Prüfung antreten. Für mich verlief die Prüfung sehr erfolgreich.
(nach bestandener II. Verwaltungsprüfung 1957)
Noch am selben Tag sind die Anwärter der Bezirksregierung zum Außerplanmäßigen Regierungsinspektor ernannt worden. Damit gab es sieben neue Regierungsinspektoren bei der Bezirksregierung, von denen jedoch fünf gleichzeitig eine Versetzungsurkunde mit Wirkung vom 1. Juli 1957 zu einem Landratsamt erhielten. Ich selbst bin zum Landratsamt in Altenkirchen versetzt worden, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet und mein erster Sohn Markus bereits "unterwegs" war. Ich habe dies als besondere Benachteiligung empfunden, zumal der jüngste der Anwärter bei der Bezirksregierung bleiben durfte, also nicht versetzt worden ist. Wir vermuteten, daß dies darauf zurückzuführen ist, daß sein Vater in gehobener Position ebenfalls bei der Bezirksregierung beschäftigt war. Vier andere ehemalige Anwärter wurden zu den Landratsämtern Bad Kreuznach, St. Goar, Zell und Neuwied versetzt.
Die Bekanntschaft mit meiner späteren Frau Marlies lief ziemlich parallel zu meiner Ausbildung.
Das entscheidende Ereignis trat anläßlich der Kirmes am 26. August 1951 auf der Karthause ein, als ich auf Einladung meiner Tante Lisbeth (dieselbe, die in Reifferscheid mit ihren Kindern Loni und Marga während der letzten Kriegsmonate zusammen mit uns evakuiert war) im Kirmeszelt an einer Tanzveranstaltung teilnahm.
(meine spätere Frau Marlies mit 17 Jahren)
Damals ist mir Marlies, die an einem Nebentisch saß, erstmals bewußt aufgefallen. Ich hatte sie zwar vorher schon öfters gesehen; denn sie arbeitete in einem Zigaretten- und Getränke-Kiosk am Markenbildchenweg, an dem ich auf dem Schulweg immer vorbeigekommen war, aber das war letztmalig eineinhalb Jahre früher. Nachdem ich mehrmals mit Marlies getanzt hatte, bat mich ein junger Mann, auf seine Schwester aufzupassen, weil er selbst etwas anderes vorhatte. Es war Marlies' Bruder Klaus, mein heutiger Schwager, der selbst den Auftrag hatte, Marlies zum Tanz mitzunehmen, obwohl ihm das wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen hatte. In mir fand er einen dankbaren Stellvertreter. Und seit diesem Tag hat sich mein Leben entscheidend verändert. Wir kannten uns viereinhalb Jahre, als wir im Januar 1956 heirateten. Zu diesem Zeitpunkt war abzusehen, daß ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Verwaltungsprüfung bestehen würde. Und diese Annahme ist dann auch Wirklichkeit geworden.
* * *
Mit dem Fahrrad zum Bodensee
(18) - Von einem Ereignis möchte ich zum Schluß berichten, obwohl es zeitlich vor meiner Eheschließung lag, mit der ich - wie im Vorwort angedeutet - den Bericht abschließen will. Es war ein Ereignis, wie ich es bis dahin nicht gekannt habe. Achtzehn Jahre war ich alt geworden, die Schule hatte ich abgeschlossen und eine Stelle gefunden. Gewissermaßen als Belohnung gönnte ich mir einen längeren selbständigen Urlaub mit den Freunden Willi Thone, Hans Kleemann und Hans Zenz. Wir unternahmen eine 14tägige Radtour an den Bodensee. Meine Freunde hatten neue Fahrräder mit Dreigang-Kettenschaltung bekommen. Ich selbst verfügte noch nicht über ein neues Fahrrad und mußte deshalb mit dem Rad meines Vaters fahren, das zwar neu war aber noch nicht über eine Schaltung verfügte. In den Sommerferien ging es los, verabschiedet von unserem gemeinsamen Freund Gerd Breidbach, der selbst gerne mitgefahren wäre aber wegen einer Erkrankung leider nicht mitfahren durfte.
(Start zum Bodensee)
Die erste Nacht verbrachten wird in Ingelheim am Rhein. Hier fanden wir Unterkunft bei Verwandten von Willi Thone. In der zweiten Nacht schliefen wir in einem Gasthaus in Bühl (Baden), das wir aufgesucht hatten, weil es fast den ganzen Tag geregnet hatte und wir aus diesem Grunde - völlig durchnäßt - nicht zelten wollten. Auf der restlichen Tour übernachteten wir immer im Zelt - von der letzten Nacht abgesehen, auf die ich noch zurückkommen werde, und zwar in einem Zelt, das wir jeden Abend aus Dreiecks-Wehrmachts-Zeltplanen zusammenknüpfen mußten. Jeder von uns hatte eine solche Dreiecks-Zeltplane.
Diese Radtour an den Bodensee habe ich in guter Erinnerung behalten. Es war eine Fahrt, auf der wir viel Spaß miteinander gehabt haben, obwohl wir nur über geringe Geldmittel verfügen. Ich selbst mußte in diesen zwei Wochen mit 75 Mark auskommen. Wir fuhren über normale Straßen, die zum Teil in keinem guten Zustand waren; denn Radwege gab es damals nicht. Die Strecke führte zunächst linksrheinisch am Rhein vorbei in Richtung Süden über Mainz, wir wechselten dann auf die andere Rheinseite und fuhren über Groß-Gerau - Darmstadt - Heidelberg (hier regnete es in Strömen) - Freiburg im Breisgau - Höllental - Hinterzarten - Titisee - Bärental - Feldberg - Schluchsee - Singen - Überlingen - Konstanz - Insel Mainau - Meersburg - Friedrichshafen - Ravensburg - Sigmaringen - Heilbronn - Heidelberg (hier regnete es wie auf der Hinfahrt) - Darmstadt - Rüdesheim am Rhein - Braubach - Koblenz.
Wir fuhren also vorbei an Rhein und Odenwald, durchquerten den Schwarzwald, erklommen den Feldberg, überquerten den Bodensee auf einer Autofähre (eine solche hatten wir bis dahin noch nie gesehen), mühten uns durch's bergige Schwabenländle, erfreuten uns am Neckar und legten insgesamt fast 1400 Kilometer zurück - und das alles ohne jede Panne!
Ärger hat es nur einmal gegeben. Es war am Neckar, und es regnete stark. Wir waren ziemlich durchnäßt und froren und hatten alle die Absicht, so schnell wie möglich wieder zurück nach Hause zu kommen. Willi Thone und ich wollten die Strecke und eine Neckarschleife abkürzen und deshalb über den Berg fahren. Das wollten Hans Kleemann und Hans Zenz nicht - wegen der Steigungen; sie meinten, entlang des Neckars ginge es doch schneller und weniger anstrengend.
An einer Straßengabelung trennten sich unsere Wege, weil niemand nachgeben wollte. Willi und ich bogen nach links ab auf die Bergstrecke, die beiden anderen fuhren geradeaus. Willi und ich hofften, die anderen in Heidelberg wieder zu treffen. Aber diese Hoffnung platzte. Also fuhren wir allein weiter. Gegen Abend erreichten wir das Vorland von Darmstadt und wir beschlossen, hier in einem Kornfeld zu übernachten; denn ein Zelt konnten wir nicht errichten, weil uns zwei Zeltplanen fehlten; die hatten die beiden anderen, die ebenfalls nicht zelten konnten. Am nächsten Morgen - wir hatten miserabel geschlafen - fuhren wir weiter und gedachten, noch am selben Abend zu Hause zu sein. Unterwegs versuchten wir, per Anhalter auf einem Lastwagen mitgenommen zu werden. Dies gelang uns in Rüdesheim. Ein Fahrer ließ uns auf die Pritsche seines Wagens, uns so fuhren wir ohne Anstrengung rechtsrheinisch zurück nach Koblenz, wo wir um die Mittagszeit ankamen.

(Rast in Bärental/Schwarzwald mit Titisee im Hintergrund)
Natürlich wollten wir wissen, ob und wie die beiden anderen nach Hause gekommen waren. In den späten Nachmittagsstunden trafen wir sie. Bis dahin hatten sie geschlafen; denn sie sind todmüde morgens gegen acht Uhr nach Hause kommen. Weil sie nur zwei Zeltplanen hatten und deshalb nicht zelten konnten, seien sie ohne Unterbrechung durchgefahren, erzählten sie. Das war - wie wir fanden - eine große Leistung. Immerhin waren die beiden etwa 24 Stunden ohne Unterbrechung im Sattel und hatten so die Strecke Heilbronn - Koblenz bewältigt. Diese Leistung ist umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, daß wir eine Etappe zuvor die schwierige Strecke Sigmaringen - Heilbronn über 171 Kilometer gemeinsam zurückgelegt hatten. Die beiden hatten es damit fertiggebracht, die Strecke Sigmaringen - Koblenz mit nur einer Unterbrechung zu fahren. Hans Kleemann meinte dazu, auf der letzten Strecke entlang des Rheins hätten sie wegen totaler Übermüdung höchstens noch einen 15-Kilometer-Stundendurchschnitt erreicht und aufpassen müssen, nicht einzuschlafen und damit vom Fahrrad zu fallen.
* * *
(19) - Wie ich im Vorwort angedeutet habe, möchte ich die Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend hiermit beenden und keine Ausführungen machen zu der Zeit, in der ich verheiratet bin.
(Nach der Hochzeit im Standesamt Koblenz im Januar 1956)
Nicht weil hierüber nichts zu berichten wäre, sondern weil dies mein Vorhaben sprengen würde, und ich auch nicht die Absicht habe, Details aus dieser Zeit weiterzugeben. Damit keine falschen Schlüsse gezogen werden, betone ich ausdrücklich, daß ich meine Ehe mit Marlies als eine glückliche Zeit ansehe und auch mit Stolz auf unsere drei Söhne Markus, Rafael und Martin blicke.
|

Markus
|

Rafael
(jeweils nach erfolgreichem Abitur)
|

Martin
|
Noch immer betrachte ich unsere Verbindung als eine harmonische Ehe und hoffe, daß sie noch einige Jahre - möglichst verschont von schwerwiegenden Alterserscheinungen - andauert.
Nicht schließen möchte ich aber, bevor ich meinen Eltern Dank abstatte, für alles, was sie mir und meinen Geschwistern getan haben. Sie haben sich aus der Familie verabschiedet - Vater im Oktober 1982, Mutter im Juli 1989 - wie sie gelebt haben: Ohne großes Aufsehen, einfach und bescheiden, im 80ten bzw. 87ten Lebensjahr. So, wie beide im Leben ausschließlich für ihre Kinder da waren, so hielten sie es auch bei ihrem Tod. Es gab kein Krankenlager, kein schmerzhaftes und schmerzliches Vorbereiten. Sie haben ihre Kinder selbst bei ihren letzten Atemzügen noch verschont.
Ich hoffe und wünsche, daß sie dort sind, wofür sie immer gebetet haben!
* * *
|